Sport bei Krebs: "Der Trainingsreiz muss individuell sein"
Joachim Wiskemann vom Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen erklärt, warum Sport Krebskranken hilft. Er sagt, jeder müsse mehr Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen.

Bewegung sei wie ein Medikament, allerdings sei der Wert des Themas noch nicht flächendeckend verstanden, sagt Joachim Wiskemann vom Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg. Dort werden Krebspatienten medizinisch behandelt und gleichzeitig angeleitet, in die begleitende Trainingstherapie einzusteigen.
Wie wichtig ist Sport, oder sagen wir Bewegung, in der Krebstherapie?
Joachim Wiskemann: Das Wording umreißt das Dilemma bei der Vermittlung des Themas schon ganz gut. Viele Patienten assoziieren mit dem Wort "Sport" gleich so etwas wie "Leistungssport" und bekommen Angst, dass sie diese Art von Belastung nicht schaffen. "Bewegung" ist ein Begriff, mit dem manche mehr anfangen können, aber was ist Bewegung? Wir bewegen uns ja schon während wir hier sitzen und sprechen. Um einen gesundheitlichen Trainingseffekt zu haben, muss man seinen Körper aber gewissen Reizen aussetzen und regelmäßig an die Grenzen des individuell Leistbaren gehen.
Das heißt konkret?
Wiskemann: Das Wort "individuell" ist entscheidend. Es bedeutet, dass der Trainingsreiz in Abhängigkeit vom eigenen Leistungsniveau bei jedem Patienten unterschiedlich ist, gleichzeitig aber auch von jedem erreicht werden kann. Bei einem Marathonläufer muss der Trainingsreiz zum Beispiel sehr umfangreich sein, bei einem schwachen onkologischen Patienten sind nicht selten wenige Minuten ausreichend.
Regelmäßiges, intensives Training ist für viele Gesunde schon eine große Herausforderung.
Wiskemann: Ja, und in der Onkologie sind wir in einer besonderen Situation. Unsere Patienten sind im Durchschnitt 69 Jahre alt, viele haben zusätzlich zu ihren onkologischen Problemen Begleiterkrankungen und sind funktionell eingeschränkt, können sich zum Beispiel schlecht bewegen. Gleichzeitig haben die Patienten es mit den Nebenwirkungen der Krebstherapie zu tun, die alle Strukturen im Körper schwer belastet. Dennoch ist ein Training für jeden onkologischen Patienten machbar, da es immer an die individuellen Möglichkeiten angepasst wird.
Für manchen wahrscheinlich schwer vorstellbar, dass diese Patienten sich zusätzlichen Belastungen durch Training aussetzen sollen.
Wiskemann: Und doch ist die Wissenschaft dazu eindeutig. Es gibt hunderte von Studien, die den Nutzen von begleitender Trainingstherapie in der Onkologie nachweisen und jährlich verdoppelt sich das Wissen. Die Nebenwirkungen einer Krebstherapie werden durch eine gute, individuelle Trainingstherapie zurückgedrängt, das onkologische Medikament wirkt vielfach besser und kann womöglich auch in höherer Dosis verabreicht werden. Insgesamt ist die Prognose für Patienten, die "Sport" machen, besser.
Was sagen Sie Menschen, die Angst haben, sich durch Training zusätzlich zu schädigen?
Wiskemann: Natürlich wird man nicht in den ersten zwei, drei Tagen nach einer großen Operation intensives Krafttraining machen. Aber mit ein paar Tagen Abstand und der richtigen Dosierung können zum Beispiel auch Frauen nach einer Brustkrebs-OP ins Training einsteigen. Leider hat sich dieses Wissen auch noch nicht bei allen Kollegen durchgesetzt. Ich führe viele Telefonate mit Operateuren, die auf dem Entlassbrief "kein Sport" notiert haben. Dabei ist schon lange klar: Regelmäßige körperliche Aktivität ist mit einer deutlich reduzierten Sterblichkeitsrate assoziiert.
Gibt es Kriterien, die gegen Sport sprechen?
Wiskemann: Wir haben noch keine Symptomatik gesehen, auf die sich Training nachteilig ausgewirkt hätte. Man dachte früher, Krafttraining bei Knochenmetastasen könnte dazu führen, dass Knochen leichter brechen. Aber auch diese Sorge hat sich als unbegründet herausgestellt. Wenn man natürlich einen Stoma-Beutel nach einer großen Bauchraum-OP trägt, sollte man unkontrollierten Körperkontakt in klassischen Kontaktsportarten vermeiden, aber sonst spricht nichts gegen Training und Bewegung.
Welche Sportarten haben einen besonders guten Effekt?
Wiskemann: Aus wissenschaftlicher Perspektive sind die Sportarten am besten untersucht, in denen man Belastung genau quantifizieren und Effekte dadurch messen kann. Das gilt für Ausdauersportarten − also alles von Walking bis Joggen. Und es gilt für Krafttraining. Inzwischen gibt es auch gute Daten zu Yoga oder zu Training, das Gleichgewicht und Koordination fördert.
Was davon ist besonders gut?
Wiskemann: Die perfekte Übung gibt es nicht. Es geht darum, das Training individuell anzupassen. Für manche Patienten reichen vielleicht 90 Minuten intensiver Bewegung pro Woche, damit sie sich besser fühlen, andere brauchen mehr Reize oder weniger. Manche Patienten haben klassische B-Symptomatiken. Das heißt, sie sind in einem schlechten körperlichen Zustand, weil sie schon lange Probleme hatten, aber der Krebs nicht sofort erkannt worden ist. Bei ihnen geht es zunächst darum, den Muskelzustand wieder herzustellen, das Ausdauertraining kommt danach.

Welchen Effekt hat Bewegung auf die Psyche?
Wiskemann: Für manche Patienten bedeutet das Training die Möglichkeit, selbst etwas zum Erfolg der Therapie beizutragen, also selbstwirksam zu werden. Andere bekommen durch den Sport Abstand zu ihrer Erkrankung.
Während ihrer Zeit am NCT Heidelberg werden die Patienten angeleitet, ins Training einzusteigen. Wie geht es danach für sie weiter?
Wiskemann: Wie es zu Hause weitergeht, ist der kritische Punkt. Wir haben dafür das Netzwerk Onko-Aktiv gegründet, unter dessen Dach Physiotherapeuten, Fitnessstudios und Sportvereine zusammengeschlossen sind. Inzwischen kommen wir auf rund 60 Einrichtungen im Umkreis von 100 Kilometern um Heidelberg, auch in der Region Heilbronn. Wir bieten regelmäßig Fortbildungen und Qualitätszirkel an, um die Einrichtungen im Umgang mit Krebspatienten zu schulen. Aber klar ist: Der Wert des Themas Bewegung ist noch nicht flächendeckend verstanden.
Was meinen Sie damit?
Wiskemann: Wir brauchen andere Strukturen in unserem Gesundheitssystem, um die positiven Effekte von Bewegung und gesunder Ernährung besser zu nutzen. Die beste Situation wäre, wenn wir es durch mehr Aufklärung und bessere Anreize schaffen würden, dass manche Erkrankungen gar nicht erst entstehen. Ich sage das auch wegen der Alterspyramide. So wie das jetzt läuft, wird das nicht weitergehen können. Jeder muss mehr Verantwortung für seine eigene Gesundheit übernehmen und die Politik muss die Rahmenbedingungen dafür schaffen, damit das besser gelingt.
Zur Person
Professor Joachim Wiskemann (43) ist Sportwissenschaftler und Sportpsychologe sowie Leiter der Gruppe "Onkologische Sport- und Bewegungstherapie" in der Abteilung für Medizinische Onkologie am NCT Heidelberg.




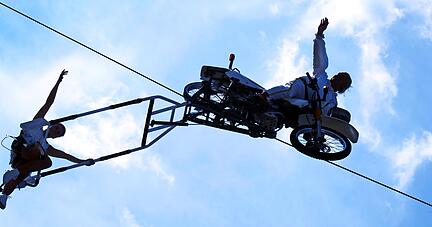
 Stimme.de
Stimme.de