Baden-Württemberg ist ein Land der Vielfalt
Was zeichnet die Menschen im Südwesten aus? Zugezogene berichten über ihre Erfahrungen mit Badenern und Württembergern

Was macht Baden-Württemberg und die Menschen, die hier leben, aus? Man müsse in die Vergangenheit blicken, um die Gegenwart zu verstehen, sagt Ausstellungsleiter Rainer Schimpf vom Haus der Geschichte Stuttgart. "Sie prägt uns bis heute." Im Jahr 1790 wurde der Südwesten von etwa 250 Herrschern regiert - von Protestanten und Katholiken, die der Kirche in Rom unterworfen waren. Es gab unzählige Adelsgeschlechter und freie Reichsstädte wie Heilbronn, in denen sich ein Bürgerstolz ausprägte, der bis heute zu spüren sei, wie Schimpf sagt.
Diese Zersplitterung, die Vielfalt der Herrschaftsformen, habe dazu geführt, dass es auch heute nichts "Uniformes" wie in anderen Nationalstaaten gebe. Die Stärke der baden-württembergischen Wirtschaft resultiert nach Meinung von Schimpf ebenfalls aus dieser Diversität. "Quasi jeder kleine Ort hat einen Weltmarktführer." Das sei historisch zu begründen. "Jedes Dorf hat geschaut, dass der eigene Kirchturm höher ist als der im Nachbardorf." Es habe sich großer Heimatstolz entwickelt und vielfältige Industrien. "Wir haben über das ganze Land verteilt erfolgreiche Firmen, nicht nur im Zentrum Stuttgart. Das ist etwas Besonderes."
Der Saarländer schätzt die geselligen Menschen
"Ein Saarländer will eigentlich immer zurück in die Heimat", sagt Andreas Stenger, Chef des LKA Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart. Daraus wurde nichts, seit 1986 ist Stenger im "Ländle" und seitdem beruflich viel herumgekommen.
"Jede Region hat einen typischen Schlag Menschen, die sich ihre Traditionen bewahrt haben", sagt er. Man spüre im Gespräch schnell "ganz viele regionale Identität". Die Mannheimer etwa seien geprägt von ihrer Industriegeschichte und der extremen Diversität der Stadtgesellschaft, die Kraichgauer vom Wein, die Badener trügen "ihr Herz auf der Zunge", im eher pietistisch geprägten Stuttgart müsse man häufig "erstmal das Eis brechen".
Gemein sei den Menschen in Baden-Württemberg, dass sie "gesellig sind und sich ihrer jeweiligen Region verbunden fühlen", sagt der 59-Jährige. Damit seien sie den Saarländern ähnlich. Nicht umsonst ist das Land ein "Global Player", findet er. Die große Vielfalt habe auch zahlreiche bahnbrechende Erfindungen hervorgebracht: das Auto, das Rad, Weltkonzerne wie SAP. Die Diversität sei vielleicht auch der größte Unterschied zu seiner früheren Heimat, dem kleinen Saarland, das bis zum Niedergang der Industrie ab Mitte der 1970er-Jahre fast ausschließlich von Kohle und Stahl geprägt war.
Andreas Stenger, 59, ist Präsident des Landeskriminalamts Baden-Württemberg. Geboren ist er in Homburg/Saar.
Schwätzen als Hürde für die Norddeutsche
Katrin Math lebt seit 2006 in Heilbronn und seit ihrem Studium in Mannheim ab 1992 mit Unterbrechungen in Baden-Württemberg. Sie liebt ihre neue Heimat. "Es gibt eine unglaubliche Vielfalt." Mannheim sei anders als Lahr, wo sie ebenfalls einige Zeit verbrachte, Heilbronn unterscheide sich wiederum deutlich von beiden. Heilbronn habe so vieles zu bieten: als Stadt am Fluss, mit der abwechslungsreichen Umgebung, den Veranstaltungen und dadurch, dass die Stadt "offen ist in alle Richtungen". In Cuxhaven, wo sie den Großteil ihrer Kindheit verbracht hat, komme nach Norden einzig die Nordsee.
Die Vielfalt des Landes zeige sich auch beim Essen. "Im Norden gibt"s bei geselligen Anlässen Kartoffelsalat und wenn wir Fleisch wollen Labskaus." Im Südwesten habe Essen und Trinken einen ganz anderen Stellenwert. "Die Menschen hier sind nach meinen Erfahrungen gastfreundlich, gesellig und sie schwätzen gern", sagt sie. Eine Eigenschaft, die sie sich noch mehr zu eigen machen will. "Ich arbeite an mir, gerade in neuen Situationen fällt es mir nicht leicht, einfach draufloszureden, wie das viele hier tun." Durch ihre klare norddeutsche Art und das Hochdeutsch habe sie schon manchmal den Eindruck, Menschen schlechter zu erreichen. "Dialekt signalisiert einfach Zusammengehörigkeit."
Katrin Math, 51, ist Personalleiterin an der Hochschule Heilbronn HHN. Geboren ist sie in Delmenhorst.
Chance, um neue Identitäten zu schaffen
"Es gibt nicht den Baden-Württemberger, ich kann das zumindest nicht erkennen", sagt Thomas Bornheim. Seit eineinhalb Jahren lebt der Geschäftsführer der Programmierschule Ecole 42 in Heilbronn, zuvor war er sieben Jahre in den USA, hat in Berlin studiert und die unterschiedlichsten Jobs gemacht. Die Leute in seiner "Bubble", seinem Umfeld, seien sehr aufgeschlossen, die Umgebung dynamisch, er fühle sich wohl. "So stark war der Kulturschock nicht als ich hergekommen bin." Amüsant findet Bornheim die Sprüche, die er manchmal von Einheimischen hört: "Der Teufel ist ein Eichhörnchen" zum Beispiel oder die Verwendung von "wo" als Relativpronomen wie in "der Mann, wo".
Bornheim sieht es als große Chance für Heilbronn und die Region, dass es keine "eindeutige kulturelle Konfiguration" gibt. "Ich sehe nichts, was mir sagt, das hier ist Baden-Württemberg. Das Liebliche, Kleine fehlt in Heilbronn völlig." Dadurch gebe es Platz und Räume, um verschiedene Menschen zusammenzubringen und kreativ zu sein, neue Kulturen und Identitäten zu schaffen, findet er. Ohnehin müsse man sich bei der Frage "Wer macht die Zukunft?" klarmachen: Nur ein kleiner Teil der Menschen unter 30 Jahren stammt aus Heilbronn, die Mehrzahl habe einen Migrationshintergrund.
Thomas Bornheim, 46, ist CEO der Ecole 42 Heilbronn, geboren ist er in der Nähe von Bremen.

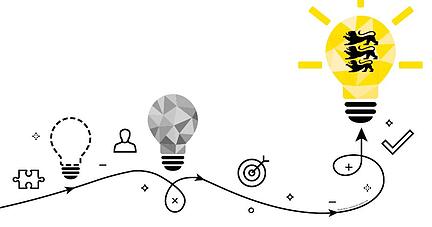

 Stimme.de
Stimme.de