Versorgungslücke im Pflegebereich: Warum die Suche nach Fachkräften so schwierig ist
In der Gesundheitsbranche werde Fachkräfte dringend gesucht, deshalb rekrutieren Einrichtungen wie das Klinikum Stuttgart oder die SLK-Kliniken auch im Ausland. Doch der Prozess ist komplex und langwierig.

Schon heute fehlen in vielen Bereichen des Gesundheitssektors Fachkräfte, etwa in der Pflege. Aufgrund des demographischen Wandels könnte sich die Versorgungslücke im Pflegebereich bis 2035 auf insgesamt knapp 500.000 Fachkräfte vergrößern, prognostiziert das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Die Bundesregierung will deutlich mehr ausgebildete Kräfte nach Deutschland holen. Bei einer Reise nach Brasilien im vergangenen Juni warben Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) höchstpersönlich vor Ort gezielt um Pflegekräfte.
Anteil ausländischer Fachkräfte in Pflegeberufen hat sich seit 2017 fast verdoppelt
Nach Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) gab es 2022 rund 1,68 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in den Pflegeberufen. Darunter waren insgesamt 244.000 ausländische Pflegekräfte, vor allem aus EU-Ländern. Der Anteil insgesamt hat sich zuletzt von acht Prozent 2017 auf 14 Prozent 2022 nahezu verdoppelt.
Schon seit etwa 15 Jahren gibt es am Klinikum Stuttgart Aktivitäten zur Rekrutierung von Pflegekräften aus dem Ausland – zunächst vor allem aus EU-Ländern, inzwischen auch von Drittstaaten wie dem Westbalkan oder Nordafrika. Sie rekrutierten aus ethischen Gründen aber nur in Ländern, die selbst keinen Mangel haben, sagt Pflegedirektor Oliver Hommel. Etwa 50 Personen kämen pro Jahr aus dem Ausland hinzu – bei insgesamt etwa 3000 Köpfen im sogenannten Pflege- und Funktionsdienst. Das sei relativ zur Zahl von Beschäftigten eine niedrige Zahl. "Unser Hauptfokus liegt auf Ausbildung und Qualifikation am Standort."
Hommel sagt, die Integration ausländischer Pflegefachkräfte sei komplex und gelinge nur mit strukturierten Prozessen und einem funktionierenden Integrationsmanagement. "Wir haben Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Das kann man nicht dem Zufall überlassen."
Oliver Hommel (Klinikum Stuttgart): Man braucht ein professionelles Integrationsmanagement
Seine Mitarbeiter fliegen ins Herkunftsland, um dort Bewerbungsgespräche zu führen, holen die Neuankömmlinge vom Flughafen ab, kümmern sich um Wohnung, Behördengänge, den Spracherwerb und das Ankommen im deutschen Alltag.
Im Klinikum gelte es dann, die Menschen nicht nur fachlich, sondern vor allem menschlich eng zu begleiten, zum Beispiel, weil Pflege in manchen Herkunftsländern einen ganz anderen Stellenwert habe als in Deutschland. Während hierzulande die Pflege "vollumfänglich" sei, übernehme beispielsweise andernorts die Familie ganz viel, Pflegeleistungen beschränkten sich auf das Bedienen von Maschinen. Auch der Umgang mit Schmerz sei kulturell sehr unterschiedlich.
SLK will pro Jahr 50 Pflegekräfte aus dem Ausland gewinnen
"Die Akquise qualifizierter Fachkräfte im pflegerischen Bereich aus dem Ausland ist auch für den SLK-Verbund ein bedeutender Faktor", heißt es schriftlich vom regionalen Verbund. Ziel sei es, "jährlich rund 50 Pflegekräfte aus dem Ausland für uns zu gewinnen. Wir unterstützen beim Ankommen in Deutschland, helfen bei Anträgen oder bei der Wohnungssuche und beim Spracherwerb." Insgesamt hat SLK nach eigenen Angaben 2379 Köpfe im Pflege- und Funktionsdienst. Für ausländische Kräfte seien "die Hürden des Anerkennungsprozess noch immer sehr herausfordernd", so dauere der Prozess der Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland erworbener Abschlüsse durch das Regierungspräsidium drei bis vier Monate. Die anschließenden Qualifizierungsmaßnahmen benötigten acht bis zwölf Monate, die Beurkundung der erworbenen Abschlüsse noch einmal zwei bis drei Monaten.
Die Zusammenarbeit mit manchen Behörden klappt besser, es hakt aber nach wie vor bei den Ausländerbehörden
Es habe bei einigen Behörden in den vergangenen Jahren "deutliche Verbesserungen" in den Abläufen gegeben, sagt Oliver Hommel. Auch die Zusammenarbeit mit dem Welcome Center in Stuttgart laufe "hervorragend". Die Engstelle, die er identifiziert, sind die Ausländerbehörden. "Wir hängen an deren Tropf." Häufig seien alle Vorbedingungen erfüllt, doch dann dauere es Monate, bis die Behörde tätig werde. So lange könnten die neuen Kräfte nicht arbeiten. "Das ist insgesamt problematisch."
Im Sommer hatten Medien bundesweit über "Chaos" bei der Ausländerbehörde in Stuttgart und teils monatelange Wartezeiten berichtet, laut einer SWR-Recherche von Mitte Februar habe sich die Situation nur "minimal verbessert", immer noch warteten Menschen lange auf einen Aufenthaltstitel. Die Wartezeiten seien nur weniger sichtbar, weil sie in den Onlinebereich verschoben worden seien und die Menschen nicht mehr vor dem Amt campierten, heißt es.
Die OECD hat herausgefunden: Viele Zugezogene erleben Ressentiments im Alltag
Zu den bürokratischen Hürden kommen Ressentiments in der Bevölkerung. Wie aus einer im Januar vorgelegten Studie der Industriestaaten-Organisation OECD hervorgeht, berichten Zugezogene von Rassismus und Diskriminierung im Alltag in Deutschland. Das betreffe vor allem die Wohnungssuche und das öffentliche Leben auf der Straße, in Restaurants und Geschäften. "Deutschland hat noch keine ausgereifte Willkommenskultur, daran müssen wir arbeiten", sagt auch Oliver Hommel. Soviel sei sicher: "Der Pflegemangel wird sich verschärfen." Der SLK-Verbund sei "offen für Fachkräfte aus allen Kulturen", heißt es von dort. "Interessierte beziehungsweise Menschen, die von Pflegekräften aus dem Ausland wissen, die gerne in Deutschland arbeiten würden, dürfen sich jederzeit gerne melden."
Die Landesregierung in Stuttgart setzt weiter auf das Programm Triple Win gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit und der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Das Land übernehme die Kosten für den Spracherwerb im Ausland, wie es aus dem Gesundheitsministerium heißt. So seien 2023 "über die Sprachkursförderung 111 neue Pflegekräfte" für Baden-Württemberg gewonnen worden.


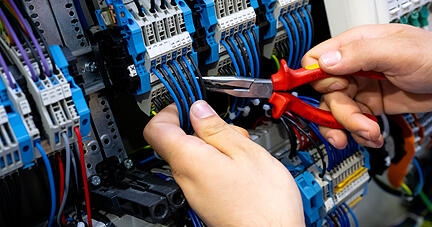
 Stimme.de
Stimme.de