Neue Berechnung bei der Grundsteuer: Antworten zu allen wichtigen Fragen
Die Grundsteuer zählt zu den wichtigsten Einnahmequellen für Kommunen. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts musste sie reformiert werden, ab Januar greift ein neues Berechnungsmodell. Was sich damit genau ändert.
Mit Beginn des neuen Jahres greift für die Grundsteuer eine neue Berechnung: Weil das bisherige Modell nach einem Entscheid aus dem Jahr 2018 verfassungswidrig war, wurde die Steuer reformiert – mit Auswirkungen auf Eigentümer, Mieter und Kommunen. Das Wichtigste auf einen Blick:
Was ist die Grundsteuer?
Die Grundsteuer wird auf Grundbesitz erhoben. Hierzu gehören Grundstücke einschließlich der Gebäude sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft. Gezahlt wird sie grundsätzlich von den Eigentümern. Bei Vermietungen kann die Grundsteuer aber auch über die Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden.
Warum ist die Grundsteuer so wichtig?
Die durch die Grundsteuer erzielten Einnahmen fließen ausschließlich den Städten und Gemeinden zu. Derzeit sind es mehr als 15 Milliarden Euro jährlich, teilt das Bundesfinanzministerium auf seiner Webseite mit. Damit zählt die Grundsteuer zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Die Mittel benötigen die Gemeinden, um damit Schulen, Kitas, Schwimmbäder oder Büchereien zu finanzieren und Investitionen in die Infrastruktur vorzunehmen.
Warum wird zwischen Grundsteuer A und B unterschieden?
Das A steht für „agrarisch“. Diese Grundsteuer wird auf land- und forstwirtschaftliches Vermögen erhoben. Das B steht für „baulich“. Der Grundsteuer B unterliegen alle Grundstücke, die bebaubar oder bereits bebaut sind.

Wie wird die Grundsteuer bisher berechnet?
Die bisherige Berechnung basiert auf Jahrzehnte alten Grundstückswerten (den sogenannten Einheitswerten). Im Westen werden die Grundstücke nach ihrem Wert im Jahr 1964 berücksichtigt. In den ostdeutschen Ländern sind die zugrunde gelegten Werte sogar noch älter, sie beruhen auf Werten aus dem Jahr 1935. Diese Einheitswerte werden mit einem einheitlichen Faktor, der sogenannten Steuermesszahl, und anschließend mit dem Hebesatz multipliziert. Während die Steuermesszahl nach altem Recht bundeseinheitlich festgelegt ist, wird der Hebesatz – und damit letztlich die Grundsteuerhöhe – von den Gemeinden bestimmt.
Warum musste die Grundsteuer reformiert werden?
Das Bundesverfassungsgericht hat das bisherige Bewertungssystem 2018 für verfassungswidrig erklärt, da es gleichartige Grundstücke unterschiedlich behandele und so gegen das im Grundgesetz verankerte Gebot der Gleichbehandlung verstoße. Bis 31. Dezember 2019 sollte eine gesetzliche Neuregelung getroffen werden, die spätestens ab dem 1. Januar 2025 als Bewertungsgrundlage diene. Die Grundsteuer in ihrer bisherigen Form konnte übergangsweise bis zum 31. Dezember 2024 weiter erhoben werden.
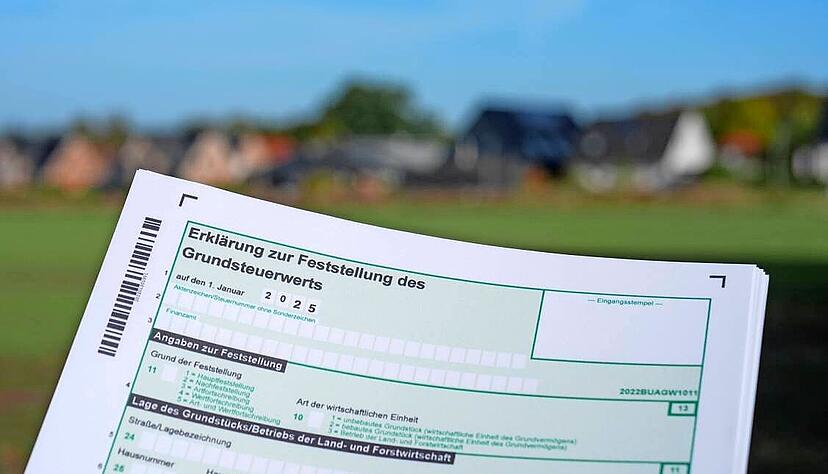
Grundsteuerreform: Was ändert sich bei der neuen Berechnungsmethode?
Das grundsätzliche Verfahren wird beibehalten. Statt des Einheitswertes aber soll in Baden-Württemberg das Bodenwertmodell richten. Die Bodenrichtwerte ergeben sich aus den Verkaufserlösen der vergangenen Jahre und werden vom örtlichen Gutachterausschuss festgelegt. Mit Bodenrichtwert, Grundstücksgröße und bei eigener Nutzung einem Abschlag ergibt sich die Messzahl, die mit dem neu festzulegenden Hebesatz multipliziert wird. Daraus können die Kommunen die endgültige Grundsteuer ab dem Jahr 2025 festlegen.
Steigt mit der neuen Berechnung die Grundsteuer?
Es wird Gewinner und Verlierer geben: Eigentümer, die mehr zahlen müssen – und Eigentümer, die weniger zahlen werden, schreibt das Bundesfinanzministerium. Das gilt entsprechend auch für Mieter von Wohnhäusern, da die Grundsteuer in Deutschland komplett als Nebenkosten umgelegt werden darf.
Nehmen Kommunen durch die Grundsteuerreform mehr ein?
Nein. Die Grundsteuerreform soll für die Kommunen möglichst aufkommensneutral sein. Das heißt: Städte und Gemeinden sollen infolge der Reform keine höheren Einnahmen haben. Das Finanzministerium hat dazu im Vorfeld erklärt: "Sollte sich in einzelnen Gemeinden abzeichnen, dass sich das Grundsteueraufkommen wegen der Neubewertung verändert, besteht für die Gemeinde die Möglichkeit, ihre Hebesätze anzupassen und damit einer Veränderung des Grundsteueraufkommens entgegenzuwirken."
Anpassung der Hebesätze: Wie sieht das in der Praxis aus?
Die Kommunen in der Region haben sich durch die Bank weg in den letzten Monaten mit dem Thema beschäftigt. Erst in dieser Woche senkte beispielsweise die Stadt Heilbronn den Hebesatz der Grundsteuer B von derzeit 500 auf 345 Punkte für 2025. Aber auch hier zeigt sich: Es wird Härtefälle geben, wie Stadtkämmerin Heike Wechs angedeutet hat: "Es wird Grundstücke geben, für die mehr Grundsteuer bezahlt werden muss, es wird aber auch Immobilien geben, bei denen die Steuer geringer ausfällt." So wie überall.
Kommentare öffnen
 Stimme.de
Stimme.de
Kommentare
Jürgen Mosthaf am 15.11.2024 06:56 Uhr
Dass die Kommunen dadurch gleichbleibende Einnahmen haben, bleibt abzuwarten. Immerhin wurde ein Faktor, die Bodenrichtwerte, nochmals schnell vor der Reform angehoben. Nur halb Richtig ist, dass die Gemeinden aus den Einnahmen Schulen, Kitas und Schwimmbäder und Büchereien finanzieren. In Heilbronn finanziert die HVG die defizitären Stadtwerke, denen man die Busse, Bäder und die Eishalle aufs Auge gedrückt hat über die Einnahmen aus dem Gasgeschäft. Eine halb gare Quersubvention zu Lasten der Bürger über die Energieversorgung. Die Steuereinnahmen werden zu aller erst für den stetig steigenden Personalaufwand bei immer schlechter werdenden Leistungen gebraucht. Der nächst höchste Haushaltsposten sind die sogenannten Sozialausgaben - ebenso stetig steigend. Auch dies gehört zur Wahrheit dazu. Eine kritische Betrachtung ist dieser Artikel sicherlich nicht.
Jürgen Mosthaf