Wenn Künstliche Intelligenz den Menschen ersetzt: Linienrichter bei ATP-Turnieren vor dem Aus
Ab 2025 setzt die ATP auf der großen Tour auf technische Lösungen bei der Frage: drin, oder draußen? Dem Tennis droht ein Nachwuchsmangel. Beim Neckar-Cup sind die Meinungen zur Entscheidung geteilt.

Auf dem Tennisplatz ist es wie im echten (Berufs-)Leben: "Ich bin zweimal ‚overruled" worden", sagt ein junger Linienrichter nach Schichtende beim Challenger-Turnier am Trappensee. Es passiert im Laufe eines Tennis-Matches öfter, dass "Aus"-Rufe der Linienrichter von ihrem Vorgesetzten kassiert, überstimmt werden. Das sorgt mitunter bei den Spielern für Verstimmung. Das Gute bei Sandplatzturnieren wie dem Neckar-Cup: Der Ballabdruck ist eine prima Diskussionsgrundlage, im Zweifelsfall schaut sich der Stuhlschiedsrichter letztinstanzlich den Tatort an. Doch nun übernimmt die Technik.
Vor wenigen Wochen hat die Spielervereinigung ATP die Entscheidung getroffen, dass ab 2025 auf der kompletten ATP-Tour nicht mehr Linienrichter urteilen, ob ein Ball drin oder draußen war, sondern ein elektronisches Live-System, also Künstliche Intelligenz (KI). Die Abschaffung der Linienrichter wird das Spiel ohne Zweifel gerechter machen. Aber auch für Probleme sorgen.
Dem Tennis drohen Nachwuchsprobleme
"Dies ist ein Meilenstein für unseren Sport und einer, den wir nicht ohne sorgfältige Überlegung erreicht haben", sagte ATP-Chef Andrea Gaudenzi Ende April. Seit 2017 habe es Tests gegeben. Tradition sei ein Kern des Tennis und "Linienrichter haben eine wichtige Rolle über die Jahre gespielt", erklärte der ehemalige Profi. Aber Tennis verdiene nun einmal "die genaueste Form" der Entscheidungsfindung.
"Es gibt viele Fehlentscheidungen, wenn es wichtig ist. Und in der Weltspitze geht es um zwei, drei Punkte, die ein Match entscheiden", weiß Hans-Jürgen Ochs. Der 57-Jährige aus Gemmingen ist Supervisor beim Neckar-Cup, Vertreter der ATP. Für ihn ist klar: "Das Menschliche geht verloren." Und es werde ein Nachwuchsproblem geben. "Als Linienrichter hat man den besten Platz, um zu lernen, sieht den großen Schiedsrichter hautnah zu. Das ist die beste Schule."
Erfahrung lässt sich nur in der Praxis sammeln
Der normale Weg sei immer gewesen, als Linienrichter bei Challenger-Turnieren anzufangen, auf ATP- und Grand-Slam-Ebene weiterzumachen und womöglich (Stuhl-)Schiedsrichter zu werden. Das war auch der Weg von Hans-Jürgen Ochs, der einst als Linienrichter bei den Heilbronn Open in Talheim begann. Er sagt: "Du kannst nicht auf den Platz gehen und schiedsen. Jede Situation ist anders, das muss man zunächst an der Seite miterlebt haben."
ATP, Schwesterorganisation WTA und der Tennis-Weltverband ITF wissen um die Problematik, deshalb werde man sich zusammensetzen, so Ochs. Eine Branche im Wandel: "Wir werden viele Linienrichter verlieren" - weil Profi-Linienrichter auf Challenger-Ebene zu wenig verdienen und auf ATP-Ebene nicht mehr gebraucht werden.
35 Linienrichter aus 35 Nationen im Einsatz
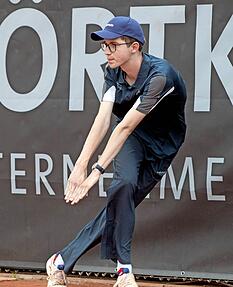
Heilbronn bekommt den runden KI-Park, der Neckar-Cup bald KI an der Linie? "Auf Challenger-Ebene kommen die Maschinen noch lange nicht. Denn die kosten noch verdammt viel Geld", versichert Ochs, ohne Zahlen nennen zu können. Menschen verursachen auch Kosten.
Beim Neckar-Cup sind diese Woche 35 Linienrichter aus sieben Nationen, darunter Brasilien und Kasachstan, im Einsatz. "Der Tagessatz pro Linienrichter liegt bei 45 Euro", sagt Co-Turnierdirektorin Mine Cebeci. Das Quartier müsse selber bezahlt werden. "Die internationalen Linienrichter, die wir hier haben, sind sehr erfahren, machen das als Nebenberuf", sagt ihr Mann Metehan Cebeci. "Beim Gros unserer Linienrichter ist es ein Hobby."
Gemischte Gefühle bei den Profi-Spielern

"Beim Turnier 2022 lagen unsere Ausgaben für Linienrichter knapp unter 10.000 Euro", sagt Turnierdirektor Metehan Cebeci, der appelliert: "Tennis braucht Linienrichter und Ballkinder. Falsche ‚Aus"-Rufe gehören dazu." Sehen das auch die Profis so?
"Grundsätzlich ist es eine sehr gute Idee, der Technik zu vertrauen", sagt der Kolumbianer Daniel Elahi Galan. "Auf Sand macht die Maschine aber Fehler, deshalb sollte man noch einmal darüber nachdenken." Der Argentinier Facundo Diaz Acosta ist hin und her gerissen, Andrey Golubev findet es gut - im Glauben, es spare Kosten. Was definitiv nicht so ist. Der Kasache bedauert, dass die Linienrichter ihren Job verlieren werden, führt aber das K.o.-Argument an: "Du hast keine Diskussionen mehr. Gegen die Maschine hast du keine Argumente."
Auch Marko Topo war einst Ballkind
Der Serbe Nenad Zimonjic sagt: "Die Leute lieben diese Einblendungen, ob der Ball drin oder draußen ist. Es ist gut, die Möglichkeit zum Checken zu haben. Aber ich glaube, dass es besser ist, soweit es geht den Menschen im Spiel zu lassen."
Der Münchner Marko Topo ("Ich war bei den BMW Open ein, zwei Mal Ballkind.") findet die Entwicklung "sehr schade", die Welt werde halt überall immer elektronischer. Ja, auch auf dem Tennisplatz ist es wie im echten (Berufs-)Leben: Dem Thema KI muss sich jeder stellen.




 Stimme.de
Stimme.de
Kommentare