KI könnte künftig Arztbriefe schreiben
Künstliche Intelligenz ist in einigen Bereichen der Medizin schon im Einsatz, doch das Potenzial sei noch viel größer, sagen Forscher. Am Fraunhofer-Institut IAIS wird daran gearbeitet, Prozesse im Krankenhaus durch KI zu verbessern.

Künstliche Intelligenz ist in der Medizin bislang vor allem bei der Mustererkennung ein Thema. Etwa in der Radiologie, wo KI Entscheidungen unterstützt. "Damit hat es angefangen", sagt Dario Antweiler. Der Mathematiker und Informatiker leitet den Bereich Healthcare Analytics beim Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS) in Sankt Augustin. Doch das Potenzial für die Optimierung medizinischer und nicht medizinischer Prozesse im Krankenhaus sei noch viel größer.
Eine Reihe von Anwendungsbeispielen sind denkbar
Auf der Ebene medizinischer Prozesse könne KI künftig zum Beispiel helfen, Kontra-Indikationen, also schädliche Wechselwirkungen, verschriebener Medikamente zu erkennen. KI soll in der Lage sein, Risikoprognosen für Patienten auf Intensivstationen zu erstellen oder die Verweildauer eines Patienten im Krankenhaus zu berechnen. Auch bei den nicht medizinischen Prozessen zählt Antweiler eine Reihe von Anwendungsbeispielen auf: Planungsoptimierung von Operationssälen und Personal, Terminmanagement, Abrechnungen.
Außerdem ist da der große Block der Arztbriefe. Rund 150 Millionen Arztbriefe werden pro Jahr in Deutschland geschrieben, eine Arbeit, mit der ein Arzt teilweise bis zu drei Stunden täglich beschäftigt ist und die wegen des hohen Zeitaufwands sehr unbeliebt ist. Diese künftig mit KI zu generieren, sei eines der Themen, an denen seine Gruppe gerade arbeite, sagt Antweiler. Das Problem: "Es gibt im Prinzip keine standardisierten Vorlagen." Gerade den zweiten, ausformulierten Teil, die sogenannte Epikrise, schreibe jeder Arzt in seinem Stil. Das zweite Problem: "Der Arztbrief muss absolut faktenzentriert sein." Fehler, wie sie in derzeit schon verfügbaren Text-Bots in großer Häufigkeit enthalten sind, dürfe es bei KI-generierten Arztbriefen natürlich nicht geben.
Es soll Textvorschläge für Arztbriefe geben
Bis 2026 läuft das Projekt. Antweiler hofft, dass seine Gruppe bis dahin eine Version entwickelt hat, mit der eine Art Semi-Strukturierung möglich ist. Also ein Zwischenschritt, in dem die KI zum Beispiel einen Textvorschlag macht, den der Arzt dann weiterbearbeiten kann. Klar ist für ihn aber auch: "Bis dahin wird die Medizin nicht komplett strukturiert sein. Ärzte wollen ihre Freiheit behalten."
Doch liefert das deutsche Gesundheitssystem überhaupt genügend strukturierte Daten, anhand derer die KI lernen kann, um einsatzfähig zu sein? Antweiler teilt die ganz harsche Kritik nicht, die einige Wissenschaftler in Zusammenhang mit fehlenden Daten zur Corona-Pandemie in Deutschland vorgebracht haben. In Registern von medizinischen Fachgesellschaften, wie dem Krebsregister oder dem Traumaregister, gebe es schon sehr gute standardisierte Datengrundlagen. "Wir reden uns manchmal auch schlechter als wir sind." Was eben fehle, seien übergreifende Datensätze, die interoperabel seien, also strukturiert zwischen Institutionen austauschbar. "Aber auch das beschleunigt sich."
Die Datenerhebung im deutschen Gesundheitswesen ist gar nicht so schlecht
Antweiler nennt Beispiele: Das Forschungsdatenzentrum Gesundheit, das beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) angesiedelt ist, sammelt Abrechnungsdaten der gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland, um sie für Forschungszwecke nutzbar zu machen. Immer mehr Krankenhäuser schließen sich zusammen und kaufen gemeinsam Software, statt auf Insellösungen zu setzen. Wird die elektronische Patientenakte (ePA), die Karl Lauterbach jetzt im Widerspruchsverfahren einführen will, helfen, den Prozess der Datengewinnung zu beschleunigen?
Da brauche es schon noch Zwischenschritte, sagt Antweiler. Der Vorschlag des Fraunhofer-IAIS dazu sei es, mit einer sogenannten Datenspende aus den persönlichen Gesundheitsdaten zu arbeiten. Das heißt: Den Versicherten die Möglichkeit einräumen, individuell zuzustimmen, damit ihre anonymisierten Gesundheitsdaten für die Forschung genutzt werden können. In der Corona-Pandemie war eine solche Datenspende schon über die Corona-Warn-App möglich. "Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist unterschiedlich. Deshalb ist es immer sinnvoller, so etwas optional zu machen", sagt der Wissenschaftler.
Es gilt, die KI an gesellschaftliche Rahmenbedingungen anzupassen
Wie steht Antweiler zur Diskussion um die Risiken der KI? Ängste seien begründet, räumt er ein: "Mit jedem Werkzeug kann man auch die falschen Dinge tun." Von einem Moratorium, wie es kürzlich eine Gruppe um Tesla-Chef Elon Musk gefordert hatte, hält er jedoch nichts. "Sechs Monate würden nicht ausreichen, damit die Gesellschaft zu einer Entscheidung kommt. Und die Unternehmen forschen sowieso weiter", sagt er.
Es sei wichtig, dass Informatiker die Anwendungen nicht alleine entwickelten, "sondern im Austausch stehen mit Politikwissenschaftlern, Soziologen, der Gesellschaft als Ganzes". Man könne KI-Anwendungen durchaus so steuern, dass sie gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Werten entsprechen.



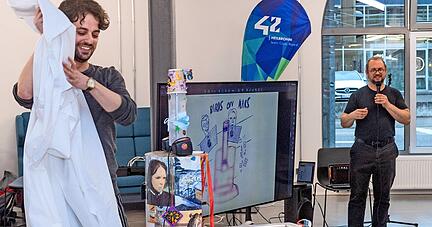
 Stimme.de
Stimme.de