Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steuert in eine ungewisse Zukunft
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht nach der Schlesinger-Affäre unter hohem Druck. Die Vorschläge, wie man ihn reformieren könnte, sind zahlreich. Komplett abgeschafft wird das System aber ziemlich sicher nicht, analysieren unsere Autoren.
Die Affäre um die frühere RBB-Intendantin Patricia Schlesinger setzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) unter Druck. Sie soll sich hohe Boni, teure Dienstwagen und eine opulente Chefetage geleistet haben. Außerdem wird der 61-Jährigen Vetternwirtschaft vorgeworfen. Am Montag wurde Schlesinger daher fristlos entlassen. Reue sucht man indes vergeblich. Über ihren Anwalt erklärt Schlesinger, sie sei der "Sündenbock" einer "politisch motivierten" Entscheidung.
Der Skandal hat eine Grundsatz-Debatte über die Zukunft von ARD, ZDF und Deutschlandradio ausgelöst. CDU-Chef Friedrich Merz forderte die Sender auf, den Fall aufzuklären und sich auf den Informationsauftrag zu konzentrieren. ARD und ZDF hätten eine der vielleicht letzten Gelegenheiten, Fehler aus eigener Kraft zu korrigieren. Die restliche ARD-Führung entzog dem RBB gar in einem beispiellosen Vorgang das Vertrauen.
Wie groß die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Öffentlich-Rechtlichen ist, ist schwer nachvollziehbar. In Umfragen geben viele Deutsche an, dass ihnen der Rundfunkbeitrag von 18,36 Euro im Monat (davor 17,50) zu hoch ist oder dass sie ihn nicht zahlen möchten. Zahllose Petitionen fordern die Abschaffung der Gebühr. Ohne Erfolg, obwohl es eine Petition im Sommer 2020 in den Bundestag schaffte. Der Petitionsausschuss wies die Forderung, ARD und ZDF aus Steuern zu finanzieren, ab. Das sei "mit dem verfassungsrechtlich verankerten Grundsatz der Staatsferne des Rundfunks nicht zu vereinbaren".
Andererseits genießt der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein hohes Vertrauen, das in der Pandemie noch gestiegen ist. Das zeigt eine Langzeitstudie der Universität Mainz, in der 70 Prozent der Befragten ARD und ZDF zum Jahresende 2020 ihr Vertrauen aussprechen.
Steuermodell in anderen Ländern
Reformen des ÖRR werden dennoch seit Jahren gefordert, nicht nur in Deutschland. Frankreich hat die Rundfunkgebühr gerade abgeschafft. Bis 2024 sollen die Sender über Steuern finanziert werden und sich bis dahin erneuern. 2018 stellte Dänemark auf ein Steuer-Modell um und strich viele Sender. In Deutschland ist dieser Schritt derzeit nicht in Sicht. Im Gegenteil: Als Sachsen-Anhalt die jüngste Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent blockierte, wurde das Land vom Bundesverfassungsgericht zum Einlenken gezwungen. Die Richter sahen einen Verstoß gegen die Rundfunkfreiheit und untermauerten: Dem ÖRR stehe "ein grundrechtlicher Finanzierungsanspruch zu". Die inhaltliche Vielfalt könne "über den freien Markt nicht gewährleistet werden".
An Gedankenspielen über die Zukunft des ÖRR mangelt es dennoch nicht. 2021 schlug SWR-Intendant Kai Gniffke vor, den Südwestrundfunk und den Saarländischen Rundfunk weitgehend zu verschmelzen. Es sei an der Zeit, "Dinge zu denken, die bislang unvorstellbar gewesen wären", sagte er. Der Medienjournalist Stefan Niggemeier warf die Idee auf, das ZDF abzuschaffen. Es gebe historische Gründe, warum zwei Sender entstanden sind, die ARD sei mit ihren Regional-Sendern aber breiter im Land verwurzelt. "Eigentlich ist das totaler Luxus, dass wir uns diese zwei Systeme erlauben."
Der Medienrechtler Wolfgang Schulz fordert, den Sendern ein festes Budget zuzuteilen, das sich an der Preisentwicklung orientiert. Sie sollen dann entscheiden, wie sie ihr Programm gestalten. Laut Schulz könnte so die Finanzierung entschlackt werden.
Die Finanzwächter von der KEF
Bisher läuft es so: Die Sender melden für vier Jahre an, was sie ausgeben wollen. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) prüft dann, ob die Vorschläge den Rundfunkauftrag erfüllen und "wirtschaftlich und sparsam" sind. Falls nicht, streichen die Finanzwächter das Budget. Das birgt manche Überraschung. Zuletzt hat die KEF 1,5 Milliarden Euro, die die Sender ausgeben wollten, nicht genehmigt. Dabei ging es etwa um das WDR-Filmhaus in Köln, dessen Baukosten sich auf 240 Millionen Euro verdreifacht haben. Es gebe "erhebliche Zweifel an der Wirtschaftlichkeit", erklärt das Gremium. Zuvor rügten die Aufseher, dass die Gehälter bei ARD, ZDF und Deutschlandradio zu hoch seien und der Aufstieg in höhere Gehaltsstufen zu schnell gehe.
Der SWR baut zurzeit im Schwabenhof in Heilbronn ein neues Studio. Das sei kein Widerspruch zum "schwäbisch haushaltenden" Rundfunk, meint SWR-Rundfunkrätin Marianne Kugler-Wendt. "Regionale Berichterstattung ist der öffentliche Auftrag." Die Region Heilbronn-Franken habe in der Vergangenheit zunehmend an Bedeutung gewonnen. Investiert werde in erster Linie in die Ausstattung. Der SWR müsse mit dem technischen Fortschritt mithalten und Sendungen schnell produzieren und ausspielen.
Mit dem bisherigen Programm-Angebot ist die Hohenloher SWR-Rundfunkrätin Catherine Kern zufrieden. Durch die Vielzahl an Fernsehsendern komme man dem Programmauftrag nach. In den Mediatheken treffe man auf ein breites Angebot und "sehr gute Filme".
Sparvorhaben, die nicht jeder sieht
Manche Sparvorhaben sind von außen nicht sichtbar. Das berichtet ein Gremiums-Mitglied eines Senders im Gespräch mit unserer Redaktion. "Es wird etwa daran gearbeitet, die Archive aller Sender zusammenzulegen." Zudem werde die SAP-Nutzung für alle Sender vereinheitlicht. "Das ist eine große Herausforderung." Auch die Auslandsberichterstattung von ARD- und ZDF-Korrespondenten solle besser organisiert werden.
Das ist nicht alles: Seit 2011 läuft nachts auf allen Pop-Radiosendern die ARD-Popnacht. Im Sommer 2021 gingen die vielen Mediatheken in der gemeinsamen ARD-Mediathek auf. Und bei der Fußball-WM 2018 sendeten ARD und ZDF aus einem gemeinsamen Studio, was Millionenbeträge eingespart haben soll.
Radikalere Schritte fordert der Ökonom Hanno Beck von der Hochschule Pforzheim: weniger Sendeanstalten; eine Steuer zur Finanzierung des ÖRR statt einer Gebühr. Er sieht außerdem eine Tendenz bei den Öffentlich-Rechtlichen, sich weiter auszudehnen. Deren zusätzliche Angebote im Internet bedrohten die Meinungsvielfalt. Private Medienunternehmen, die es auf dem Markt schwer haben, stießen im Wettbewerb auf eine durch acht Milliarden Euro subventionierte Sendeanstalt.
Kritik an Gästeauswahl in den Talkshows
Bei inhaltlicher Kritik sieht der ÖRR-Insider Luft nach oben. "Wenn Sie sich fragen, was die Gremien in den letzten zehn Jahren am meisten beschäftigt hat, waren es die Talkshows." Seit Jahren hagele es Programmbeschwerden von Zuschauern: über die Auswahl der Gäste, die Themen. Die Kritik werde geprüft und mit Redaktionen besprochen − da die meisten Talkshows von ausgegliederten Firmen produziert werden, entgleite den Sendern jedoch die Kontrolle. "Die berechtigte Kritik wurde jahrelang nicht umgesetzt."
Fehlende Kontrolle kritisiert auch SWR-Rundfunkrat Dr. Rainer Podeswa. "Ob Rundfunkrat, Verwaltungsrat oder die Rechtsaufsicht durch die Landesregierungen − alle Kontrollebenen geben noch nicht einmal vor, eine Kontrolle ausüben zu wollen und tun dies natürlich auch nicht."
Der Insider verteidigt die langwierige Arbeit der Gremien jedoch, wenn sie sich als Anwälte der Zuschauer sehen. "Es ist ein demokratischer Weg des Austausches." Generell betont er den Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. "Das ist ein System, das in der Welt einzigartig ist." Die wichtigste Aufgabe der Sender sei die unabhängige, ausgewogene Berichterstattung. "Glaubwürdigkeit muss man sich verdienen. Das wird ein harter Weg, der der ARD jetzt bevorsteht."
ARD-Programmdirektorin Christine Strobl verteidigt die Sendungen. "Die ARD baut ihr Informationsangebot beständig weiter aus, im abgeschlossenen Jahr 2021 erreichte es einen neuen Höchststand. Mit 47 Prozent machte die Information fast die Hälfte aller Sendeminuten im Ersten aus." Zum gesetzlichen Auftrag gehöre aber auch, zu unterhalten, Wissen zu vermitteln und die Interessen aller Bevölkerungsgruppen zu bedienen.
Kommentare öffnen
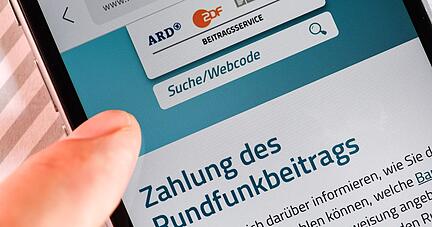

 Stimme.de
Stimme.de
Kommentare
Georg Wolf am 24.08.2022 06:11 Uhr
Die Einführung der Beitragsfinanzierung im Jahr 2013 sollte laut Initiatoren dazu dienen, die damalige Finanzkrise im örR (öffentlich rechtlichen Rundfunk) zu überbrücken und ihm Zeit für Reformen zu schaffen. Mittlerweile sind 9 Jahre vergangen und nennenswerte Reformen sind keine erfolgt. Es zeigt sich jetzt, daß die Beitragsfinanzierung in erster Linie dazu geführt hat, daß sich sogar die Führungskräfte an überbordenden Gehältern, Altersruhebezügen und Korruption bereichern. Der örR ist aus sich selbst heraus nicht mehr reformfähig und willfährige Politiker trauten sich aus Angst vor einer schlechten Presse nicht, diesen zu reformieren. Während viele Menschen im Lande noch nicht wissen, wie sie die Heizkosten des nächsten Winters bestreiten, wird im Verantwortungsbereich des örR mit ihren Beiträgen der "Tango Korrupti" getanzt. Das führt nun als Resultat direkt auch in die Krise.