Fast-Fashion und Umweltverschmutzung - Tipps für nachhaltige Mode
Wenn Arbeiter in Uganda zehn Cent für ein T-Shirt verdienen. Dorothy Kidza-Zentler aus Heilbronn-Kirchhausen gibt als Bildungsreferentin Infos und Tipps zu Fast Fashion.
Laut dem Bundesumweltministerium kaufen sich Menschen in Deutschland im Jahr durchschnittlich 60 Kleidungsstücke. Hand aufs Herz: Wann haben Sie Ihr letztes neues Kleidungsstück mit nach Hause gebracht?
Dorothy Kidza-Zentler: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Seit ich die Fortbildungen zum Thema Textilien gemacht habe, kaufe ich mir kaum noch was. Nur für meine Kinder muss natürlich ab und zu was Neues her. Aber ich leide immer sehr darunter, mit ihnen Kleidung einkaufen zu gehen. Das macht inzwischen mein Mann.
Das ist ein gutes Stichwort: Wie sensibilisiere ich Kinder für das Thema Fast Fashion, also schnelle Mode? Ein neuer Begriff für den Trend der vergangenen Jahre.
Kidza-Zentler: Das ist tatsächlich sehr schwierig, denn für Kinder hat Kleidung oft noch eine viel wichtigere Bedeutung als nur das Anziehen. Man ist in, will dazugehören. Ich spreche viel mit meinen Kindern darüber, erkläre, was dahinter steckt. Aber Jugendliche wollen oft nicht hören, wenn man sagt, schau mal, wie soll das gehen bei diesem Preis? Davon müssen viele Menschen leben können. Bei einem T-Shirt für ein paar Euro kann das nicht funktionieren.
Dazu eine Zahl, die man im Netz findet: 40 Prozent der Kleidung sieht den Kleiderschrank nur ein bis zwei Mal von außen. Stimmt das?
Kidza-Zentler: Ja, leider. Man denkt, man müsse jede Saison den neuesten Trend haben. Und dann ist vieles ja so billig. Da ist der Gedanke schnell da: Ach, das kann ich ja noch kaufen.
Das war ja nicht immer so. Wie hat sich dieser Trend entwickelt?
Kidza-Zentler: Da bewirkt die Werbung viel. Und Shoppengehen ist eine Kultursache geworden. Dazu kommen bei den jüngeren Leuten noch die Influencer, die Trends beeinflussen.
Noch einmal zurück zum T-Shirt für ein paar Euro. Wie kann das sein?
Kidza-Zentler: Kleidung ist so billig, weil andere den Preis dafür zahlen. Die Menschen in den Billiglohnländern werden von ihren Firmen und diese von den Modeproduzenten unter Druck gesetzt. Arbeiter verdienen in Uganda zehn Cent für ein T-Shirt. Wenn sie also zehn Shirts am Tag produzieren, haben sie gerade einen Euro verdient. Da kommt man auch in Afrika nicht weit. Deshalb arbeiten auch Kinder, oft schon Fünfjährige, in den Fabriken und verdienen mit dazu. Nicht überall gibt es die Schulpflicht.
Dazu kommt noch die Umweltverschmutzung.
Kidza-Zentler: Ja. Hier ein paar Beispiele: 43 Millionen Tonnen Chemikalien werden pro Jahr für die Textilproduktion eingesetzt. Dabei werden etwa 465 Gramm Chemikalien pro Kilogramm synthetischer Fasern und sogar 925 Gramm pro Kilogramm Baumwollmaterialien verwendet. Die Treibhausgas-Emissionen der weltweiten Textilproduktion entsprechen jährlich mindestens 1200 bis 1715 Millionen Tonnen CO2. Das ist mehr, als alle internationalen Flüge und die Seeschifffahrt zusammen freisetzen.
Die Produktion von zehn Jeans verursacht fast genauso viel CO2 wie einmal von Berlin nach München zu fliegen, nämlich 272 Kilogramm. Auch der Wasserverbrauch ist enorm: 2015 wurden weltweit 79 Milliarden Kubikmeter Wasser in der Modeindustrie verbraucht. Das entspricht 2608 Litern pro Tag pro Person, wenn wir es auf alle Einwohner Deutschlands aufteilen. Bei der Annahme, dass wir im Durchschnitt in Deutschland 1,44 Liter Wasser pro Tag trinken, könnten wir über fünf Jahre von dem Wasser leben, was pro Tag in der Modeindustrie verbraucht wird. Besonders in der Faserproduktion, etwa beim Anbau von Baumwolle, wird viel Frischwasser benötigt.
Das klingt alles sehr deprimierend?
Kidza-Zentler: Ist es auch. Auch der Verbrauch an Bodenfläche ist unglaublich. 85,2 Millionen Hektar Boden wurden bereits zur Produktion von Baumwolle, Zellulose oder zur Viehhaltung für die Modeindustrie umgewandelt. Dies entspricht mehr als fünf Mal der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland. Würden auf der gleichen Fläche Lebensmittel gepflanzt, könnten diese weitere 387 Millionen Menschen ernähren.
Wo können wir als Einzelne denn anfangen, was zu ändern?
Kidza-Zentler: Wir alle haben am Ende die Macht, was zu ändern. Wir müssen durch unser Kaufverhalten den Moderiesen zeigen, dass wir ihr Verhalten nicht mittragen, dass wir Veränderung wollen. Und wir müssen der Politik mit auf den Weg geben, dass sie Druck auf die Länder und die Industrie macht. Grundsätzlich muss sich in der ganzen Produktionskette etwas ändern: Das fängt bei den Rohstoffen an, geht weiter über die Arbeitsbedingungen und den Schutz der Arbeiter, dass keine Farbe mehr in die Flüsse geleitet wird, dass langlebige Textilien hergestellt und gekauft werden. Das EU-Lieferkettengesetz könnte eine große Unterstützung sein.
Was kann ich persönlich genau tun?
Kidza-Zentler: Beim Einkaufen zum Beispiel auf soziale und ökologische Siegel achten. Am besten aber nichts Neues kaufen. In Secondhand-Läden einkaufen. Altes auch mal reparieren. Denn eins muss uns allen auch klar sein: Unser Konsum ist auch ein Faktor für Fluchtbewegungen aus den betroffenen Ländern und Ursache des Klimawandels.
Wenn mir etwas nicht mehr gefällt oder passt, soll ich es denn dann überhaupt noch in die Altkleider-Container tun. Auch der Handel mit Altkleidung ist ja in Verruf geraten.
Kidza-Zentler: Ja, das ist schlimm. Leider wurde durch den Verkauf von unserer alten Kleidung in Afrika ein Großteil der dortigen Kleidungsindustrie kaputt gemacht. Viele Regierungen verdienen am Altkleidergeschäft mit, aber die Armen müssen die Kleidung kaufen. Deshalb sollte man alte Kleidung lieber zum Second-Hand-Geschäft bringen oder upcyclen.
Können Sie uns denn etwas Hoffnung machen? Ändert sich in den Köpfen der Menschen denn was?
Kidza-Zentler: Ich sehe das schon. Dabei hilft auch der Klimawandel. Ich habe die Hoffnung, dass sich unser Bewusstsein zum Thema Kleidung nach und nach ändert.
Kommentare öffnen

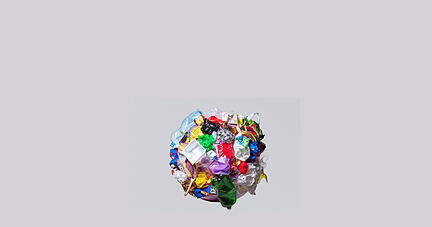
 Stimme.de
Stimme.de
Kommentare