Angst vor der Schule: Welche Folgen die Corona-Lockdowns immer noch haben
Die Corona-Pandemie ist vorbei, einige psychosozialen Folgen sind Schülern geblieben. Was Heilbronner Schulleiter, Sozialpädagogen und Psychologen beobachten und wie sie damit umgehen.
Nur Vermutungen kann Melanie Haußmann äußern, fragt man die Rektorin der Heinrich-von-Kleist-Realschule (HvK) und geschäftsführende Schulleiterin der Heilbronner Schulen (mit Ausnahme der Gymnasien) nach den psychosozialen Folgen der Corona-Pandemie.
Sie mutmaßt, Schüler seien in der ersten und zweiten Klasse nicht schulisch sozialisiert worden. Das „ist nicht evidenzbasiert“, doch jetzt, an der weiterführenden Schule, „merkt man das im sozialen Miteinander und auch im sprachlichen Können“. Und zwar unabhängig von der Herkunft der Kinder: „Das gilt für alle.“
Welche Folgen die Corona-Lockdowns für Schüler immer noch haben: Frustrationstoleranz muss geübt werden
In den ersten Schuljahren lernen Kinder miteinander auszukommen. „Kinder brauchen den Umgang mit anderen“, sagt Haußmann. „Das Miteinander kann ich nicht allein lernen.“ Und auch der Grundsatz, „je mehr ich übe, desto besser werde ich darin“, gelte nicht nur für Sport und Musik, sondern auch für das Austarieren von Nähe und Distanz und die Ausbildung von Frustrationstoleranz.
Auch außerhalb des Unterrichts seien Schüler weniger aktiv als früher, beobachtet Haußmann: weniger in Vereinen und weniger im Musikunterricht. Corona sei ein Cut gewesen, danach haben die Kinder nicht mehr dorthin zurückgefunden. Dabei seien die Vereine „Sozialisierungsagenten“ außerhalb der Schule. Die erfahrene Schulleiterin weiß: „Kinder brauchen ihre Peergroup, um zu wachsen, um sich zu entwickeln.“
Wie sich die Corona-Pandemie auf Schüler auswirkte: Lieber online als direkt miteinander spielen
Ebenso wenig wissenschaftlich bestätigen kann Haußmann ihren Eindruck, dass Online-Spielaktivitäten so wie die Online-Nutzung insgesamt zugenommen haben. „Ich kann nicht sagen, ob das coronabedingt ist.“ Aber sie sieht, dass Kinder eher online als persönlich miteinander spielen.
Corona-Folgen für Schüler: Einsame leiden an der Unverbindlichkeit
Auch die erfahrenen Schulsozialarbeiterinnen der HvK, Sabine Mäule und Renate Widmaier, finden es schwierig, kausale Zusammenhänge herzustellen: „Liegt es jetzt an Corona, oder liegt es an der grundsätzlichen Entwicklung, weil wir ja eh in einer sehr großen Transformation stecken mit der ganzen Medien?“, fragt etwa Widmaier.

Mäule weiß: „Es gibt Schüler, die in der Corona-Zeit sehr einsam waren“, und jetzt sei es für sie oft schwierig, die Kontakte von früher wieder aufzubauen, auch bei Freizeitaktivitäten. Sie litten an dieser „Zeit der Unverbindlichkeit“, wo man per Whatsapp-Nachricht auch schnell wieder von einer Feier ausgeladen werde. „Nähe und Gemeinschaft, gemeinsame Erlebnisse, sind deutlich zurückgegangen“, bedauert Widmaier. Und auch wenn es vor Corona schon aggressives Verhalten gab, habe dieses sowie Angstzustände, Depressionen und Essstörungen zugenommen.
Beratungsstelle Heilbronn: Anfragen an Schulpsychologie werden komplexer
Dass nach den Halbjahresinformationen bei der schulpsychologischen Beratungsstelle Heilbronn Hochkonjunktur herrscht, sei schon immer so gewesen, sagt Silja Marburger. Was die Fachbereichsleiterin und Psychologiedirektorin jedoch nach Corona beobachtet hat, ist: „Dass die Anfragen komplexer werden. Das heißt, wo wir früher Beratungsgespräche hatten von einem bis vier Terminen, reicht das jetzt häufig nicht mehr. Die psychischen Probleme der Schülerinnen und Schüler sind größer geworden.“
Ein Phänomen, das es schon vor Corona gab, sich seither aber häuft, ist der Schulabsentismus: „Kinder und Jugendliche, die aus verschiedensten Gründen die Schule nicht oder nicht regelmäßig besuchen.“ In diesem Fall würden schnellstmöglich Termine vergeben, denn: „Jeder Schultag zählt. Wenn sich das erst eingeschlichen hat, wird es immer schwieriger, das Kind wieder gut in die Schule zurückzubekommen.“
Welche Folgen die Corona-Lockdowns immer noch haben: Tochter entwickelte sogar einen Waschzwang
Doch warum will ein Kind nicht mehr in die Schule gehen? Eine Familie aus dem Landkreis hat diese Erfahrung mit ihrer Tochter gemacht. Die Kindergartenzeit sei wegen Corona chaotisch gewesen, erzählt der Vater. Im ersten Schuljahr musste das Kind zum Teil mit Maske im Unterricht sitzen, es gab immer wieder Lockdowns. Kurz nach Beginn des zweiten Schuljahrs, 2023, ging dann gar nichts mehr: „Sie wollte in die Schule gehen, konnte aber nicht.“
Psychisch habe sie es nicht einmal hinbekommen, sich anzuziehen. Und sie entwickelte einen Waschzwang. Der Vater erinnert sich: „Sie hat mal gefragt, als sie mit uns im Bett lag, warum zwischen uns keine Glasscheibe ist.“ Der Zusammenhang mit der Pandemie ist für die Eltern eindeutig, auch wenn sie nicht erklären können, warum sie so gewirkt hat.
Corona-Folgen für Schüler: Angst verstärkt sich durch Vermeidung
Silja Marburger erklärt drei Ängste, die Kinder vom Schulbesuch abhalten. Zunächst eine vermehrte Trennungsängstlichkeit: „Wir haben immer mehr Erst- und Zweitklässler, die es nicht schaffen, allein im Klassenzimmer zu bleiben, wo die Mutter irgendwie dabei sein oder vor der Tür sitzen muss.“ Dann gebe es eine Zunahme sozialer Ängstlichkeit. Durch die pandemiebedingten Schulschließungen seien Kinder weniger geübt darin, „soziale Bindungen einzugehen, sich im Gruppensetting zu bewegen“, untermauert sie Haußmanns Beobachtungen. Bis jetzt konnte der Mangel an sozialer Kompetenz noch nicht wieder ausgeglichen werden.
Als Drittes nennt sie die Angst vor Bewertung, „Leistungsängstlichkeit“ genannt. Auch vor Corona hatten Schüler schon Angst vor Benotung oder davor, vor der Klasse ein Referat vorzutragen, „aber es nimmt einfach zu“. Und das größte Problem: „Angst verstärkt sich durch Vermeidung.“ Daher sei es so wichtig, bei Schulabsentismus schnell zu handeln.
Schulpsychologische Beratungsstelle: Lehrkraft muss Vertrauen aufbauen
Das ist aber gar nicht so einfach. Im Fall der erwähnten Schulverweigerin machte die Schule Druck, drohte mit dem Ordnungsamt. Einmal kam die Lehrerin nach Hause und drohte mit der Polizei. „Ein Alptraum“, sagt der Vater rückblickend. Und es könne ewig dauern, bis man Hilfe findet.
Auch in der schulpsychologischen Beratungsstelle findet keine Therapie statt, nur Beratung. Man überlege gemeinsam mit den Eltern, welche Beteiligten man mit ins Boot holen muss, um dem Kind zu helfen. Bei Schulabsentismus sei es wichtig, eine vertrauensvolle Beziehung zu einer Lehrkraft aufzubauen. Daher ist für Marburger zwar die Fachlichkeit der Lehrkraft wichtig, aber viel entscheidender sei ihre Beziehungsfähigkeit.
Mehr Stellen für die Schulsozialarbeit in Heilbronn: Mit der Polizei drohen, hilft nicht
Druck auszuüben ist also kontraproduktiv. Die erwähnte Zweitklässlerin hatte das Glück, eine unterstützende Familie zu haben. Ihr half ein elfwöchiger Aufenthalt in einer abgeschiedenen Schwarzwaldklinik – ohne WLAN und Zugang zu Medien. Jetzt hat sie eine Grundschulempfehlung fürs Gymnasium bekommen. Die Klinik nahm aber nur Privatpatienten auf.
Der Heilbronner Gemeinderat hat für dieses Schuljahr 13,5 zusätzliche Stellen für die Schulsozialarbeit der Stadt genehmigt. Das begrüßen Sabine Mäule und Renate Widmaier als „Riesengewinn“ und Schritt in die richtige Richtung. Doch um die Kinder zu unterstützen müssen diese natürlich erstmal in die Schule kommen. Auch in der schulpsychologischen Beratungsstelle wurde Personal aufgestockt. Man wird dort aber gespannt beobachten, berichtet Marburger, ob sich die Situation normalisiert, wenn die ersten Kinder eingeschult werden, die als Säuglinge vom Lockdown noch nicht so betroffen waren.
Kommentare öffnen
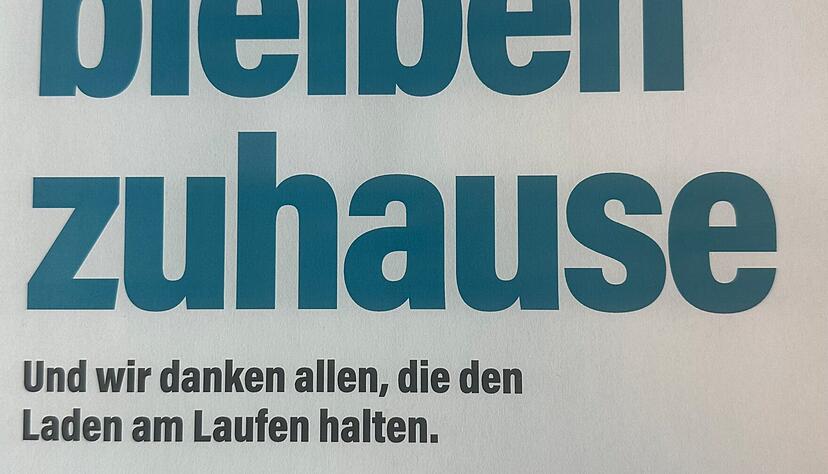
 Stimme.de
Stimme.de
Kommentare