Meinung: Die Union hatte ihre Chance, die Digitalisierung voranzutreiben
Der Wahlkampf hat gezeigt: Die Parteien haben das Internet nicht verstanden, allen voran die CDU, meint unser Autor.
Eines hat dieser Wahlkampf gezeigt: Die Union hat das Internet nicht verstanden. Das offenbarte schon Kanzlerin Angela Merkel, die 2013 sagte: "Das Internet ist für uns alle Neuland." Dabei waren Smartphones und mobiles Internet damals schon Alltag für die Deutschen, nicht aber für die regierende Politik.
Die lahmende Digitalisierung im Land trägt die Handschrift der Union. Die CSU stellt mit Andreas Scheuer den Minister für digitale Infrastruktur und mit Dorothee Bär die Staatssekretärin für Digitalisierung. Vorher war Alexander Dobrindt (CSU) mit Scheuers Aufgaben betraut. Das Ergebnis: Bei Internetgeschwindigkeit und Breitbandausbau ist Deutschland in Europa traurig abgeschlagen, zudem bezahlen wir für mobiles Internet viel Geld.
Noch 2018 hat sich die CDU-Bildungsministerin Anja Karliczek der Lächerlichkeit preisgegeben, als sie behauptete: "5G ist nicht an jeder Milchkanne notwendig." Der Spruch wurde zum geflügelten Wort: Bei jeder Gelegenheit versichern Experten aus Wirtschaft und Politik sowie Parteikollegen seitdem: Doch, 5G braucht es an jeder Milchkanne, mindestens aber den Vorgänger 4G in der Fläche und eine gute Breitbandversorgung. Beides dürfte noch lange dauern.
Die Union versenkt lieber Geld: Scheuers Funkloch-Behörde hat schon vor dem Start Millionenkosten für Berater verursacht, wurde drei Mal so teuer wie anvisiert und leistet sich zwei Chefs – verständlich, dass der Bundesrechnungshof das kritisiert.
Dabei gäbe es pragmatische Lösungen: Statt jeden Mobilfunkmast genehmigungspflichtig zu machen, könnte man eine Änderung der Landesbauordnungen voranbringen und Masten bis zu einer bestimmten Höhe ohne Genehmigung erlauben. Hessen macht das so, für Masten bis 15 Meter. Der entsprechende Passus gehört auch in der bundesweiten Musterbauordnung aktualisiert, damit wäre viel getan.
Abseits dieser strukturellen Versäumnisse fällt auf, dass die Union und Spitzenkandidat Armin Laschet einen Wahlkampf führten, der an der Realität des Internets vorbeiging. Wenn Laschet behauptet, dass er, anders als Angela Merkel, für die Ehe für alle gestimmt hätte, lässt sich das mit Hilfe des Internets in wenigen Sekunden widerlegen. Mehrere Medien dokumentierten 2017 Laschets Aussage, die Ehe sei eine "Beziehung von Mann und Frau" und seine Vermutung, die Ehe für alle sei verfassungswidrig.
Auch Laschets angebliches Bemühen um den Hambacher Forst, den er "geschützt" haben will, lässt sich leicht widerlegen. Ein heimlich aufgenommenes Video lässt sich problemlos auffinden, in dem Laschet sagt: "Ja, ich brauchte einen Vorwand. Sonst kann man ja nicht tätig werden. Ich wollte den Wald räumen." Internetnutzer sind keine Journalisten, die abwägen, ob sie ein heimlich aufgenommenes Video zeigen oder nicht. Das Problem ist nicht auf die Union beschränkt. Das Internet trug dazu bei, falsche Angaben in Annalena Baerbocks (Grüne) Lebenslauf aufzudecken und Plagiate in ihrem Buch aufzuspüren. Ebenfalls gut dokumentiert sind die Versäumnisse von Olaf Scholz (SPD) im Cum-Ex-Skandal und der Wirecard-Affäre. Für die Ewigkeit festgehalten sind die Recherchen der "Financial Times", die lange vor dem Zusammenbruch von Wirecard über Bilanzmanipulationen in dem Konzern berichtete.
Klar ist dennoch: Die Union hatte in den vergangenen 16 Jahren ihre Chance, die Digitalisierung voranzutreiben und dabei beispiellos versagt. Gefaxte Corona-Zahlen, das Fernunterrichts-Chaos, lahmendes Internet allerorten und eine noch immer heillos vorsintflutliche Staatsverwaltung zeugen davon. Ein womöglich neues Digitalisierungsministerium darf daher nicht von der Union geführt werden.
Das Internet durchzieht alle Lebensbereiche heutiger und künftiger Generationen. Es wäre an der Zeit, diese Realität anzuerkennen.
Kommentare öffnen

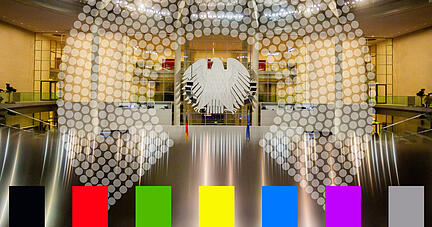

 Stimme.de
Stimme.de
Kommentare