Meinung zu Postenverteilung in Berlin: Kandidat vor Partei
Politische Lager werden bei künftigen Wahlen eine geringere Rolle spielen, glaubt unsere Autorin Ulrike Bäuerlein.
Winfried Kretschmann hielt an diesem Mittwoch bei der Landtagsdebatte über den Ausgang der Bundestagswahl am Rednerpult im baden-württembergischen Landtag ein knallbuntes Schaubild in die Höhe. Die bunte Kuchengrafik zeigte die aktuelle Zusammensetzung des Bundesrats in den Parteifarben der Regierungskoalitionen in den 16 Bundesländern: Schwarz-Gelb, Grün-Schwarz, Rot-Schwarz, Rot-Rot-Grün, Rot-Grün-Rot, Schwarz-Rot-Grün, Rot-Gelb-Grün, Schwarz-Gelb-Grün, dazu als exotische Einsprengsel noch Lila für die Linke im Osten und einmal Orange für die Freien Wähler in Bayern. Und, für Baden-Württemberg, Grün-Schwarz.
Wer regiert wo mit wem? Unübersichtlich ist gar kein Ausdruck dafür. Was Kretschmann damit anschaulich machte: Die Farbenlehre hat in der politischen Landschaft Deutschlands ausgedient. Feste Lager gibt es nicht mehr. Regiert werden kann quasi in jeder Konstellation. Keines dieser Bündnisse sei aufgrund des Bundestagswahlergebnisses plötzlich falsch oder handlungsunfähig, kommentierte Kretschmann.
Und dennoch reichen die seismographischen Ausschläge des nur in seiner Unklarheit klaren Berliner Wahlergebnisses bis nach Stuttgart, wahrzunehmen noch am Dienstag in der Fraktionssitzung der Landtagsgrünen. Erstmals wurde in diesem Gremium offen thematisiert, dass die Nachfolge von Winfried Kretschmann als grüne Spitzenfigur im Land zeitig vorbereitet werden müsse – unabhängig davon, ob diese Nachfolge, wie von Kretschmann vor der Landtagswahl versprochen, erst nach Ablauf der vollen Legislatur im Jahr 2026 oder doch schon ein, zwei Jahre früher ansteht. Klar ist nur, dass Kretschmann, derzeit 73 Jahre alt, nicht noch einmal kandidieren will. War das Thema Nachfolge bislang von höchster Stelle aus stets als irrelevant erklärt worden, brachte es nun Kretschmann selbst auf.
Damit hätten die Grünen rasch auf eine der wichtigsten Lehren aus der Bundestagswahl reagiert: Nach einer langen, durch eine Person geprägten Regierungsära weiß keine Partei mehr so genau, wo sie ohne diese Führungsperson in der Wählergunst wirklich steht. Geht der Wahl dann auch noch kurz zuvor ein solcher innerparteilicher Zerreißprozess voraus wie der CDU um Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur, köcheln Zweifel an der Eignung nebenher und bleiben die Sympathiewerte für den vermeintlichen dazu noch im Keller, können Absturz und Machtverlust fast schon eingeplant werden. Es ist das, was Armin Laschet gerade erlebt.
Die baden-württembergischen Grünen wollen nicht in diese Falle tappen, erst recht nicht, weil der Kretschmann-Faktor bei den zurückliegenden beiden Landtagswahlen deutlich höher gewesen sein dürfte als der Merkel-Faktor bei der CDU im Bund. Das heißt: Ab sofort ist der Wettbewerb um Kretschmanns Nachfolge eröffnet.
Und weil der grüne Übervater in keiner Hinsicht kopiert werden kann, wird es wohl eher um ein Kontrastprogramm gehen. Das ist eine zweite wichtige Lehre: Für viele Menschen sind die Parteien und ihre Programme umso weniger unterscheidbar, je enger sie sich in der Mitte drängeln. Gewählt werden in erster Linie Personen, nicht mehr vermeintlich in Milieus verwurzelte Parteien. Kretschmann in Baden-Württemberg, Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern, Dreyer in Rheinland-Pfalz, Söder in Bayern, Kretschmer in Sachsen und Ramelow in Thüringen stehen weniger für Parteien als für ihre Persönlichkeit. Man kann es bedauern oder begrüßen – aber fraglos wird das auch über die Kür eines Kretschmann-Nachfolgers oder einer Nachfolgerin bei den Grünen entscheiden.
Kommentare öffnen
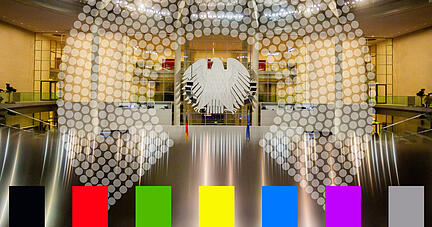

 Stimme.de
Stimme.de
Kommentare