Dem Pisa-Schock von 2001 folgt erneut ein Debakel
Nur kompetentes Personal kann beim Bildungsdrama für Abhilfe sorgen, meint unsere Autorin
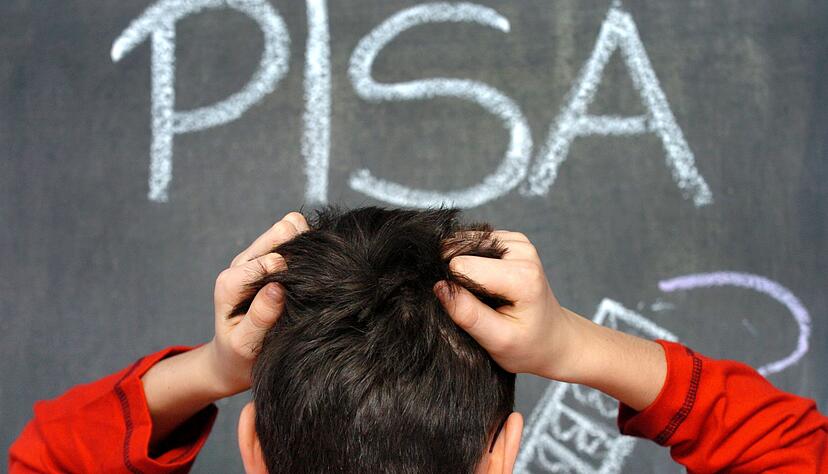
Dem Pisa-Schock von 2001 folgt wieder ein Debakel. Kein Wunder? War da nicht eine Pandemie? Die OECD-Studie stellte fest, dass in Bildungssystemen, in denen die Leistungen hoch blieben, weniger Schulen über längere Zeiträume schlossen. Man darf annehmen: Wichtig fürs Lernen ist das soziale Umfeld.
Aber nicht nur das in der Schule, auch das im Elternhaus. Hier hat sich der Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund zwischen 2012 und 2022 von 13 auf 26 Prozent verdoppelt - eine Gruppe, die auch überdurchschnittlich oft in der sozioökonomischen Betrachtung durchs Raster fällt.
Aktuelle Pisa-Studie: Immer mehr Jugendliche verfehlen Mindeststandards in Deutsch
Wie kann die sich schon im Pisa-Test 2018, also vor Corona, abzeichnende Abwärtsspirale bei den Schülerleistungen wieder umgekehrt werden? Eigentlich nur durch Personal, Personal, Personal. Kompetente Pädagogen müssen her, von Krippe und Kita an. Denn ohne Sprach- und Lesekompetenz sind Jahre später keine Textaufgaben in Mathe zu verstehen.
Der Erzieher- und Lehrerberuf muss wieder attraktiver werden, damit ihn mehr ergreifen wollen. Das funktioniert zum großen Teil zwar durch leistungsgerechte, wertschätzende Bezahlung. Man darf potenzielle Lehramtsstudierende aber auch nicht durch einen unsinnigen Numerus Clausus an den Hochschulen und Universitäten vergrämen oder ihnen die Verbeamtung durch überkommene Regeln verweigern. Um dann, wie in Baden-Württemberg geschehen, in einer Kampagne um Quereinsteiger ohne grundlegende Fachausbildung als Lehrkräfte zu werben.



 Stimme.de
Stimme.de