Warum künstliche Intelligenz für die Region wichtig ist
Alexandra Reichenbach, Wendelin Schramm und Nicolaj Stache haben das Zentrum für Maschinelles Lernen an der Hochschule Heilbronn gegründet. Im Interview erklären die drei Professoren, welche Rolle KI in der Region spielt und wofür man sie nicht braucht.

Sie haben das Zentrum für Maschinelles Lernen (ZML) an der Hochschule Heilbronn gegründet und treiben die Forschung und Ausbildung zu künstlicher Intelligenz (KI) voran: Alexandra Reichenbach, Wendelin Schramm und Nicolaj Stache. Im Interview erklären sie, welche Rolle KI in der Region spielt.
Wo begegnet mir KI im Alltag?
Alexandra Reichenbach: Wenn Sie ihre Smartwatch anmachen. Wenn sie sich Streaming-Dienste anschauen. Oder wenn Ihnen Dinge im Internet empfohlen werden.
Wendelin Schramm: (hält Smartphone hoch)
Nicolaj Stache: Wenn sie den Google-Textübersetzer benutzen. Oder wenn Sie Sprachassistenten nutzen, da werden ganz spezielle neuronale Netze eingesetzt.
Warum ist KI für die Region wichtig?
Stache: Künstliche Intelligenz ist ein wachsendes Thema, weil sie für verschiedenste Anwendungen genutzt werden kann. Ein gutes Beispiel sind neuronale Netze, die Bildinhalte klassifizieren und dabei zum Teil besser als der Mensch sind. Auch beim autonomen Fahren und im Medizinbereich ist Bilderkennung sehr wichtig. Die Region um Heilbronn ist eine sehr gesegnete Region mit großen Firmen und Weltmarktführern. Die wollen sich das Thema KI nicht entgehen lassen.
Schramm: Der Hintergrund ist die digitale Transformation all unserer Lebensbereiche. KI ist schwer isoliert greifbar und ist nicht auf einzelne Bereiche beschränkt. Sie kommt beim selbstfahrenden Auto zum Einsatz und beim Fitnesstracker, bis hin zum Blut-Glukose-Sensor, der hunderte Datenpunkte in Echtzeit an den Computer übertragen kann. All das führt dazu, dass wir zunehmend sehr große Datenbestände haben. Und es werden täglich mehr. KI ist ein Werkzeug, um mit diesen Datenmengen umzugehen.
Reichenbach: Vieles davon ist nicht neu. Wir sind aber aktuell in einer starken Hochphase. Durch immer hochleistungsfähigere Rechner ist immer mehr möglich. Es gibt kaum noch ein Feld, das nicht technologisch durchdrungen ist. Für Einsteiger ist es nicht einfach, da einen Überblick zu bekommen.
Was passiert in Heilbronn zu KI?
Stache: Es ist wichtig zu erkennen, dass wir im internationalen Wettbewerb stehen. Da hilft es nicht, wenn jeder nur seine eigene Forschung betreibt. Wir müssen über Fakultätsgrenzen hinweg denken, wir müssen weltweit denken. Es ist eine große Herausforderung für uns, für Baden-Württemberg und für Deutschland, wenn wir weltweit spitze sein wollen.
Schramm: An der Hochschule Heilbronn wollen wir natürlich mit der Forschung vorankommen. Im Zentrum für Maschinelles Lernen sind wir mit verschiedenen Fakultäten und drei Wissenschaftsdisziplinen vertreten. Wir sind in Konferenzen mit anderen Forschern verbunden und tauschen uns aus. Künftig wollen wir mit anderen Hochschulen Netzwerke aufbauen und international die Grenzen erweitern.
Reichenbach: KI ist eine Querschnittsdisziplin, die von verschiedenen Fachbereichen abgedeckt werden muss. Es gibt in fast jeder Fakultät etwas, das mit KI zu tun hat. Natürlich sind die Kerngebiete der KI im Bereich Technik und Informatik angesiedelt. In beiden Bereichen unterrichten wir vermehrt Kenntnisse die nötig sind, um KI erfolgreich anzuwenden. Ein Absolvent der Informatik behandelt heute wesentlich mehr Inhalte zu KI als noch vor zehn Jahren.
Kommt das bei den Studierenden an?
Stache: Das Thema kommt definitiv an. Die Vorlesungen, die dezidiert KI gewidmet sind, sind sehr gefragt. Es ist gut, wenn Studierende erkennen, dass man das Thema KI wirklich verstehen muss. Was kann KI? Was nicht? Viele reden immer von KI in den höchsten Tönen, aber es gibt auch Fragestellungen, die sich ohne sie lösen lassen.
Schramm: Die interessierten Studierenden sind da. Wir bieten eine praxisnahe Ausbildung mit starken Partnern in der Region.
Was muss in Deutschland noch passieren, um KI voranzutreiben?
Reichenbach: Es braucht zum Beispiel Rechenpower. Dort wo ich Daten sammele und verarbeite, komme ich ohne ausreichend Rechenpower nicht aus. Das können viele lokale Systeme nicht bieten. Wenn ich mit Serverlösungen arbeite, muss ich die Daten übertragen. Und die Datenmengen werden immer größer, da spielt 5G eine Rolle.
Stache: Es ist außerdem nicht verkehrt, neuen Techniken gegenüber positiv eingestellt und aufgeschlossen zu sein. Es stimmt, diese Entwicklungen gehen sehr schnell voran. Sicherheit und ethische Themen spielen eine große Rolle. Wichtig ist aber auch, dass wir etwa beim autonomen Fahren die Vorteile nicht außer Acht lassen.
Haben wir in Deutschland das richtige Mindset für KI?
Reichenbach: KI polarisiert immer wieder. Auf der einen Seite gibt es die, die in KI ein Wundermittel sehen, welches man bremsen muss. Auf der anderen Seite gibt es die, die auf alles Neue mit Bedenken und Skepsis reagieren. Uns fehlt ein bisschen der Mittelweg: Menschen, die begeistert sind, den Nutzen solcher Technologien erkennen, aber auch deren Grenzen sehen. Das kann man nicht über Nacht vermitteln, das ist eine gesellschaftliche Veränderung.
Schramm: Viele fremdeln mit dem Thema KI. Die Grundlagen sind Informatik und angewandte Mathematik. Wie oft hört man in der Fußgängerzone: "Aus mir ist auch ohne Mathe was geworden!" Die Möglichkeiten und die Bedrohungen durch solche Technik sind daher von Menschen mit anderem fachlichen Hintergrund schwer einzuschätzen. Das sind neue Technologien, die in Ihrer Tiefe wahrscheinlich nie Allgemeinwissen sein werden. Das müssen sie auch nicht. Wir wollen aber den Zugang dazu erleichtern, indem wir ein Grundverständnis schaffen.
Zu den Personen
Alexandra Reichenbach, Wendelin Schramm und Nicolaj Stache sind Professoren an der Hochschule Heilbronn und Leiter des Zentrums für Maschinelles Lernen (ZML). Sie haben es im Jahr 2018 gegründet. Reichenbachs Fachgebiet ist angewandte und medizinische Informatik, Schramm beschäftigt sich mit Gesundheitsökonomie und -management und Stache ist für Automotive System Engineering und Maschinelles Lernen im Industriebereich zuständig.
Welche Hürden gibt es bei Unternehmen?
Schramm: Es braucht Probleme und Fragestellungen. Wir haben das KI-Labor und möchten vielen gerne helfen. Aber wo drückt der Schuh? Dafür braucht es erstmal einen Dialog. Es muss nicht immer ein riesiges, teures Projekt sein. Da draußen gibt es unwahrscheinlich viele Probleme und Zukunftssorgen. Wir als Hochschule wollen dabei helfen, wir stehen ja nicht in Konkurrenz.
Stache: KI ist für viele ein neues Thema, das ist einfach eine Hürde. Neue Dinge erfordern immer Einarbeitung. Dazu kommt, dass sich vieles schnell ändert. Was vor zwei Jahren das beste Verfahren war, ist vielleicht längst überholt. Das macht es für KMU schwierig, weil sie nicht die Kapazität haben, diese Entwicklungen über lange Zeit zu beobachten. Da sind wir als Experten gefragt, um zu sagen: Wo fange ich da überhaupt an?
Schramm: Besonders wichtig ist mir folgendes Argument: 90 Prozent aller Daten sind jünger als zwei Jahre. Das schlimmste, was man als Unternehmen machen kann, ist warten. Ich weiß, investieren ist immer schwierig. Man muss sich bewegen. Man muss mehrgleisig fahren. Aber wenn KI Chancen bietet, sollte man sie unbedingt rasch ergreifen.
Welche falschen Vorstellungen gibt es?
Reichenbach: Schwierig sind unklare Problemstellungen: "Wir wissen nicht genau, was wir wollen, aber es soll KI dabei sein." KI ist keine Magie, KI ist komplex. Man muss seine Ziele kennen und sinnvolle Daten reinstecken, um etwas Sinnvolles herauszubekommen. Viele Daten sind gut, viele schlechte Daten helfen aber nicht. Wenn es nur an der Vorstellung hakt, was KI alles kann, können wir helfen.
Stache: Es gibt auch immer noch klassische Methoden, die nicht Unmengen an Daten benötigten. Einfachste Aufgaben muss ich nicht mit KI lösen. Man braucht nicht nur das Wissen um KI, sondern das gesamte Wissen drumherum, um einschätzen zu können: Ist KI das richtige Werkzeug? Man muss genau diese Verfahren kennen, um zu wissen, was möglich ist.
Reichenbach: Wenn ich von einer Firma höre, sie hätte alle Statistiker gefeuert, weil es ja KI gibt, dann hat diese Firma nichts verstanden. Die Methoden, die der Statistik zugrundeliegen, liegen auch der KI zugrunde. Es gibt genug Probleme, für die man KI nicht braucht und die sich auch mit Statistik oder anderen Werkzeugen lösen lassen.

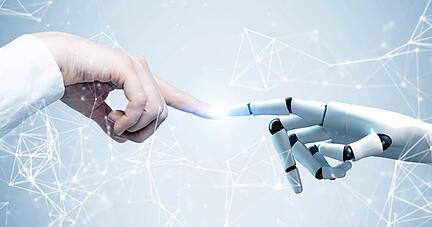
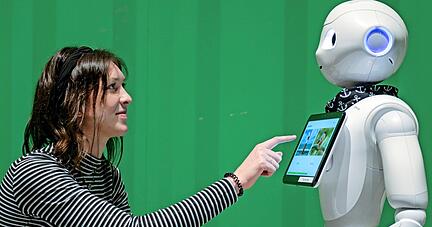
 Stimme.de
Stimme.de