Wie stark ein Erdbeben in Baden-Württemberg werden könnte
Von Basel bis Albstadt reicht die Liste der schweren Erschütterungen. Der Leiter des Erdbebendienstes berichtet über gefährdete Regionen in Baden-Württemberg.
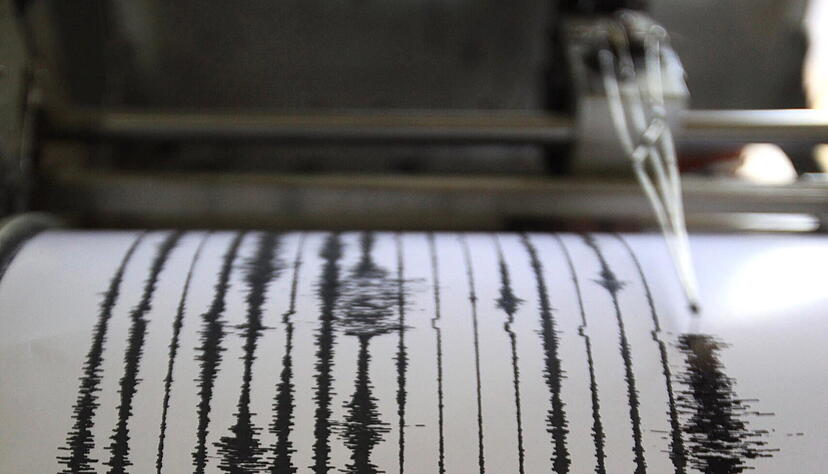
Basel 1356: Das war das stärkste Erdbeben am Oberrheingraben in historischer Zeit. Zwar gab es damals noch keinen Seismographen oder andere Messinstrumente, doch Berechnungen haben inzwischen ergeben, dass es wohl eine Magnitude von 6,9 erreichte. Das entspricht der Stärke des Bebens von Marrokko am 8. September.
"Man sieht: Solch ein Beben ist auch am Oberrhein möglich", sagte Stephan Stange, Leiter des Landeserdbebendienstes, bei der Tagung des Oberrheinischen Geologischen Vereins in Freiburg.
Wovon die Stärke eines Erdbebens abhängt
Denn die Stärke eines Bebens lasse sich gut mit der Länge in Zusammenhang bringen, entlang derer dabei die Gesteinsschichten reißen. Der Riss, der zu dem katastrophalen Tsunami vor Sumatra am Zweiten Weihnachtstag 2004 führte, erstreckte sich über tausende Kilometer – das Beben hatte eine Stärke von 9,1.
Würde der gesamte Oberrheingraben von Basel bis Frankfurt reißen, wäre die Stärke lange nicht so hoch: Es ergäbe sich eine Magnitude von 7,4 bei solch einem Riss von 300 Kilometer Länge, rechnete Stange vor. Das entspräche zwar dem Beben in der Türkei vom November vergangenen Jahres, aber Stange beruhigte: "Das ist hierzulande sehr unwahrscheinlich."
Der Odenwald wanderte 40 Kilometer nach Nordosten
Schuld daran, dass die Erde mitten in Europa immer wieder bebt, ist die Plattentektonik: Die Afrikanische Platte drückt gegen die Eurasische Platte, mit einem Zentimeter pro Jahr. Am Oberrhein ergibt sich daraus eine Verschiebung um 0,1 Millimeter pro Jahr, erläuterte er. "Im internationalen Vergleich sagt man: Bei uns ist die Erdbebengefahr mäßig."
Dennoch haben sich seit dem Aufreißen des Grabens seine Ränder schon um gut 40 Kilometer gegeneinander verschoben - der Ostteil mit Schwarzwald und Odenwald wanderte innerhalb von 20 Millionen Jahren um diese Strecke nach Nordosten. Die allgemeine Druckrichtung ist Nordnordwest-Südsüdost: So pressen die Gesteine in diesem Bereich gegeneinander.
Beben gibt es aber nicht überall gleich viele in dem Grabengebiet. Rund um Karlsruhe zittert die Erde seltener – weil die Gesteine im Untergrund heißer und damit weicher sind als anderswo. Davon profitieren auch Energieversorger: Diese Gegend eignet sich besser als alle anderen im Südwesten für Geothermie-Kraftwerke. Solche Anlagen gibt es bereits in Bruchsal und Insheim, weitere sollen hinzukommen.
Der Bebenherd auf der Schwäbischen Alb gibt Rätsel auf
Doch nicht nur im Rheintal bebt es. Seit etwa 100 Jahren werden immer wieder Erschütterungen unter der Zollernalb verspürt. Dort gibt es zwar den Zollernalb-Graben, der in Westnordwest-Ostsüdost-Richtung verläuft. Alle bislang registrierten Beben, in eine Karte eingetragen, ergeben jedoch eine Linie, die zu diesem Graben nahezu senkrecht steht, zeigte Stange bei der Tagung.
Seismografen in Heilbronn und Sindeldorf
Von Vorteil ist dabei, dass seit etwa zehn Jahren viel empfindlichere Seismometer im Einsatz sind, die auch Beben unter Magnitude 1,0 registrieren. Auch in Heilbronn und in Sindeldorf sind solche Geräte installiert. Durch ihre Messungen ergebe ein viel genaueres Bild von den Vorgängen im Untergrund. "Wir sind der Meinung, dass da vorher lange Zeit nichts los war", sagte er.
Warum dieser Erdbebenherd erst vor so kurzer Zeit entstanden ist, sei unklar. Die Beben ereignen sich in der Regel in sieben bis 15 Kilometer Tiefe entlang einer etwa 20 Kilometer langen Linie, der sogenannten Albstadt-Scherzone. Ein vollständiger Riss auf dieser Länge hätte somit Potenzial für ein Beben der Stärke 6,0 – das stärkste bislang gemessene von 1911 erreichte 5,7. Stanges Fazit: "Das ist zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich."
Bliebe noch ein Erdbebenherd im Bereich des Bodensees. Hier sei die Ursache noch völlig unklar: "Eigentlich ist das Gestein im Bereich der Erdbebenherde zu warm", sagte Stange.
Kommentare öffnen


 Stimme.de
Stimme.de
Kommentare