Medienbildung tut Not
Der Umgang mit Information und Desinformation will gelernt sein. Ein Gastbeitrag von Sibylle Thelen von der Landeszentrale für politische Bildung.
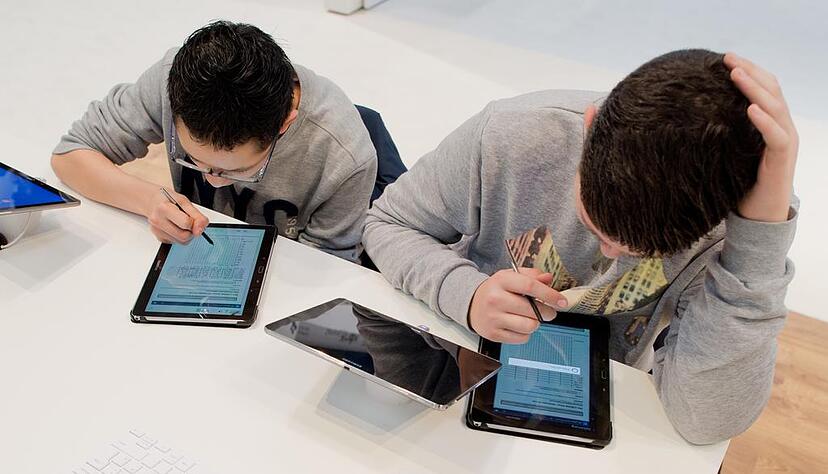
Sibylle Thelen ist Direktorin in der Doppelspitze der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und leitet seit 2011 die Abteilung "Demokratisches Engagement". Vor ihrem Wechsel in die Direktion betreute sie den Fachbereich Gedenkstättenarbeit. Sie studierte Politikwissenschaft, Turkologie und Kommunikationswissenschaft und absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München.
Lesen, Schreiben, Rechnen - ohne traditionelle Kulturtechniken lässt sich auch heute kein selbstbestimmtes Leben führen. Die Alphabetisierung breiter Schichten der Bevölkerung im 18. und 19. Jahrhundert war ein immenser gesellschaftlicher Fortschritt. Er sollte Bürgerinnen und Bürgern Zugang zur freien Meinungs- und Willensbildung eröffnen. Erst auf dieser Grundlage sind gesellschaftliche Aushandhandlungsprozesse möglich geworden. Die Alphabetisierung ist eine unabdingbare Voraussetzung unserer freiheitlich demokratischen Ordnung.
Doch heute braucht es mehr als Lesen, Schreiben, Rechnen. Im digitalen Zeitalter, angesichts sich ständig weiterentwickelnder Informations- und Kommunikationssysteme, müssen auch die Kernkompetenzen weiter gedacht und gefasst werden. Nicht nur die passive Mediennutzung, auch die aktive digitale Kommunikation als Sender und Empfänger will gelernt sein. Es bedarf der kritischen Medienkompetenz, um mit den Informations- und Desinformationsfluten des Internets selbstbestimmt und verantwortungsbewusst umzugehen.
Krtitischer Blick auf Texte, Bilder und Videos
Völlig zurecht wird allenthalben nach Medienbildung gerufen. Der kritische Blick auf Texte, Bilder und Videos muss geschärft werden. Es gilt, Fakten zu überprüfen, Quellen zu hinterfragen, die Relevanz von Informationen einzuordnen, manipulative Vermischungen von Nachricht und Kommentar wahrzunehmen, Fake News zu erkennen. Diese "Gatekeeper-Funktion", die bei den etablierten journalistischen Medien von den Redaktionen geleistet wird, muss in der digitalen Sphäre von den Nutzerinnen und Nutzern selbst übernommen werden - und will gelernt sein.
Der Beitrag, den die Medien als "vierte Gewalt" zum Gelingen unserer Demokratie leisten und geleistet haben, wird umso deutlicher, wo eine an journalistische Sorgfaltspflicht gebundene Kontrolle der Entscheidungsträger fehlt. Wo Desinformation, Fake News und Verschwörungsnarrative ungefilterte Verbreitung finden. Wo Manipulation und Fälschung, Hass und Hetze zur Grundlage von Meinungsbildung werden. Wo Bots und Trolle, etwa im Rahmen russischer Kampagnen, in Wahlkämpfe westlicher Länder eingreifen.
Gefährdetes Vertrauen in die Demokratie

Diese Entwicklungen bedrohen unsere freiheitlich-pluralistische Demokratie von innen und außen zugleich. Deshalb ist es existenziell wichtig, über die Wirkungsmechanismen zu sprechen: Desinformation, Fake News und Verschwörungsnarrative schaffen Verunsicherung und untergraben das Vertrauen in die Lösungskompetenz der gewaltenteilenden Demokratie - und dies nicht erst seit Corona. Sie spitzen Konflikte zu, treiben Polarisierung voran, blockieren Gespräche mit dem Ziel der Problemlösung. Sie zielen darauf ab, einen an der Realität ausgerichteten, evidenzbasierten Willensbildungsprozess zu torpedieren. Doch dies gefährdet den gemeinsamen, für die liberale Demokratie überlebenswichtigen Aushandlungsprozess.
Werteorientierte Medienbildung ist nötig
Es genügt deshalb nicht, nur nach Medienbildung zu rufen. Notwendig darüber hinaus ist eine werteorientierte politische Medienbildung und natürlich sind auch andere Stellen und Bereiche gefordert: Politik, Justiz, Wissenschaft, Zivilgesellschaft.
Politische Bildung ist ohne politische Medienbildung nicht (mehr) zu denken. In der Praxis verbinden sich beide pädagogischen Ansätze zunehmend: reflektierter Medienkonsum, eigenständige Gestaltung von medialen Beiträgen, selbstbestimmtes Agieren im Netz, digitale Verantwortung und Ethik. Es geht darum, Medienkompetenz im gesellschaftspolitischen Kontext zu fördern.
Werkzeuge an die Hand geben
Ziel ist eine Medienbildung, die nicht nur jungen Menschen ein Werkzeug der Welt- und Selbsterkenntnis an die Hand gibt, in der digitalen Welt, die einerseits unvorstellbar frei und weit erscheint, andererseits doch beherrscht ist von global agierenden Konzernen. Eine solche Komplexität und die Krisen unserer Zeit sind es, die Ohnmachtsgefühle und Sehnsucht nach einfachen Gewissheiten auslösen.
Wie damit umgehen? Auch das ist eine Forderung, die sich nicht zuletzt an politische Bildung und politische Medienbildung richtet. Die liberale Demokratie lebt von den Menschen: von engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die bereit und in der Lage sind, sich zu informieren, um den Meinungs- und Willensbildungsprozess zu verstehen und mitzugestalten.
Kommentare öffnen
 Stimme.de
Stimme.de
Kommentare