Heilbronn blendete die NS-Vergangenheit eines THG-Direktors aus
Karl Epting, Ex-Direktor des Heilbronner Theodor-Heuss-Gymnasiums, war NS-Ideologe, Judenhasser und Anti-Aufklärer. Nach dem Krieg führte er das THG, als wäre nichts gewesen. Bis jetzt war seine Vergangenheit kaum bekannt. Ehemalige THG-Schüler erinnern sich mit Entsetzen.
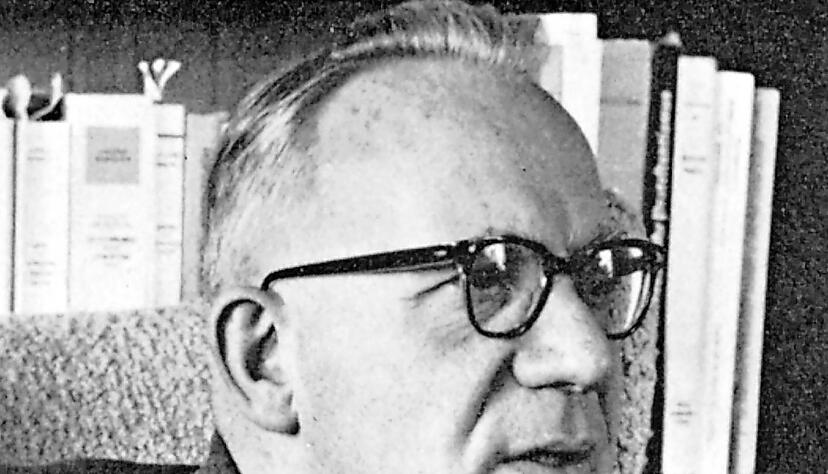
Aus allen Wolken fielen diesen Sommer gut 40 ehemalige Abiturienten des Heilbronner Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG). Bei ihrer Jubiläumsfeier "50 Jahre Abi" im Fleiner Lokal "Wo der Hahn kräht" kam das bisher kaum bekannte Vorleben ihres Ex-Direktors Karl Epting ans Licht.
Klassenkamerad Conrad Lay, ein Rundfunkjournalist, Politologe und Rechtswissenschaftler, öffnete der Festgesellschaft die Augen. Karl Epting stand 1940 bis 1944 in dem von Nazi-Deutschland besetzten Paris in der ersten Reihe: Er leitete das eigens für ihn geschaffene Deutsche Institut und − was kaum einer wusste oder wissen wollte − Epting war ein großer NS-Ideologe, schonungsloser Judenhasser und völkischer Anti-Aufklärer.
Nach dem Krieg führte er von 1960 bis 1969 das THG, als wäre nichts gewesen.
Schüler hatten sich gewundert, aber nicht hinterfragt
Für Gesprächsstoff ist weit über die Abi-Feier hinaus gesorgt. "Wir waren und sind entsetzt", berichtet der heute 69-Jährige THG-Schüler Michael Pieper: dass so jemand problemlos in den staatlichen Schuldienst übernommen wird. Dass er eine Schule, die sich dem humanistischen Menschenbild verschrieben hat, führen darf. Dass bisher gleichsam kein Hahn nach seiner Vergangenheit krähte. Und: Was würde wohl der berühmteste Absolvent sagen, auf dessen Namen die älteste Schule der Stadt getauft ist, Bundespräsident Theodor Heuss?
Weiterlesen: Wie Schule und OB auf die neuen Erkenntnisse reagieren
Unter den Absolventen des Abschlussjahrgangs 1968 herrscht inzwischen reger E-Mail-Austausch. Scheinbar harmlose Erinnerungsfetzen bekommen eine neue Dimension. So erinnern sich viele, wie "die graue Eminenz" an der Schulpforte Zuspätkommer abpasste und "im Viereck zusammenstauchte". Kaum einer ahnte, dass sein autoritärer Führungsstil mit seinem früheren Regiment zu tun haben könnte.
"Damals gab es unter den Lehrern ja noch etliche alte Säcke", meint etwa Ulrike B.. Gewundert habe man sich über Aussagen wie: Schon Adolf Hitler wollte das geeinte Europa. Hinterfragt habe es niemand.
War Epting oberster NS-Kulturfunktionär im besetzten Paris?

Lay, der in Weinsberg geboren ist und dessen Vater Christian Lay in Heilbronn Anwalt war, stützt sein Epting-Bild nicht auf Erinnerungsfetzen. Er hat sich in Frankfurt "in die Nationalbibliothek gesetzt" und aus den Jahren 1939 bis 1977 ein Dutzend Publikationen des in Berlin zum Professor habilitierten Epting durchforscht.
Auf die Spur gebracht hat ihn die Frankfurter Buchmesse, wo "Die Zeit"-Autorin Iris Radisch Epting nebenbei "obersten NS-Kulturfunktionär im besetzten Paris" nannte. Lay wollte es genau wissen.
Der 1905 als Missionarssohn in Ghana geborene Karl Epting geht unter anderem im evangelisch-theologischen Seminar in Schöntal zur Schule. Von 1924 an studiert er in Tübingen, Dijon und München Geschichte, Romanistik und Germanistik, worin er auch promoviert. Über das Studentenwerk stößt er 1934 nach Paris, wo er das Büro des Deutschen Akademischen Austauschdienstes leitet und kurz beim Auswärtigen Amt arbeitet.
1940 bis 1944 ist er Direktor des eigens für ihn geschaffenen Deutschen Instituts. Gleich beim Amtsantritt profitiert Epting vom Einmarsch der Deutschen in Polen, deren repräsentative Pariser Botschaft, das Palais Sagan, ihm fortan als Residenz dient. Hier gehen französische Kollaborateure wie Jean Cocteau und Louis-Ferdinand Celine ein und aus, aber auch deutsche Intellektuelle, Künstler und natürlich allerhand Nazis.
Es ist Eptings Sprache, die ihn entlarvt

Mit seiner vordergründig liberalen Strategie, die exakt der NS-Kriegstaktik entspricht, bewegt sich Epting auf der Linie des deutschen Botschafters Otto Abetz und damit des Führers: Solange der Krieg im Osten tobt, braucht Hitler im Westen Ruhe, stellt Lay klar.
So gibt sich Epting vordergründig frankophil, seine kulturpolitischen Aktivitäten zielen aber auf die Unterwerfung Frankreichs durch Deutschland. Seine Sprache entlarvt ihn. So forciert er Deutschkurse als "kriegswichtige Ziele der deutschen Kulturpolitik", denn die Sprache trage in sich "den Keim völkischen Denkens". Juden und "Neger" sind ausgeschlossen. Sein Ziel: "Die Vorherrschaft der französischen Kulturpolitik zu brechen." 1943 wirft er den Nachbarn vor, "eine gehässige Propaganda gegen deutschen Geist und deutsches Wesen" zu betreiben und seine Jugend "im Hass gegen Deutschland zu erziehen".
Besonders deutlich wird seine Gesinnung, wenn er unter Pseudonymen publiziert. Als Matthias Schwabe startet er 1939 einen "Generalangriff auf französische Aufklärung, katholische Kirche und Judentum", schreibt Lay. Es hätte "nie eine Judenfrage im modernen Sinn gegeben, wenn sich in der Welt nicht die Begriffe des Individuums und seiner abstrakten Freiheit von jeder organischen Bindung durchgesetzt hätten". Der Katholizismus sei "gegen die deutsche Rassenlehre" und treffe sich mit dem "Weltjudentum", indem der Papst behaupte, wir seien geistig alle Semiten. Der "totale Hass" vieler Franzosen sei dem Klerus zu verdanken. Unter eigenem Namen beklagt Karl Epting 1940 "die moderne Zivilisation ist dem Judentum hörig", dessen Zentren er in Hollywood, in der City of London und an der Wall Street wähnt.
Epting ließ Listen jüdischer Schüler fürs KZ anfertigen
Kein Tabu auch bei Raubkunst, die sich bald in der Botschaft türmt. 1940 stellt Epting eine Liste jüdischer Galerien zusammen, die man "schlagartig und in getarnter Form" ausräumen könnte. Solche Operationen machen vor Museen wie dem Louvre nicht Halt, und auch nicht vor Privatwohnungen wie denen der Bankiersfamilie Rothschild. Sein Judenhass kennt keine Schranken.
Er fordert Listen mit jüdischen Schülern anzufertigen, auf dass sie leicht von den anderen Schülern getrennt und "in den Osten verbracht" werden können, also ins KZ. Zudem erstellt er einen Index für jüdische Schriftsteller und eine Liste von Professoren, die von den Unis "entfernt" werden sollten.
Später arbeitet er als Lektor bei einem rechtsradikalen Verlag
Gegen Ende des Krieges flieht er nach Berlin und propagiert, den Untergang vor Augen, den Nationalsozialismus zur universalistischen Ideologie weiterzuentwickeln − um auf dieser Basis ein geeintes Europa unter dem Vorzeichen des Hakenkreuzes zu schaffen.
1946 übergeben ihn die amerikanischen Alliierten an die Franzosen, die ihn für mehr als zwei Jahre in einem Militärgefängnis festhalten. In seinem Tagebuch phantasiert Epting, ob der "politische Mord im großen Stil" nicht doch vielleicht ein "humanes Mittel der Ordnung" sei. Als es zur Verhandlung kommt, erwartet Kultur-Kollaborateure, anders als 1945, nicht mehr die Todesstrafe. Er wird freigesprochen, arbeitet beim rechtsradikalen Grabert-Verlag als Lektor, um 1952 problemlos in den Schuldienst zu wechseln.
In Heilbronn wurde Epting mitunter als "Glücksfall" betrachtet
In Heilbronn ist Eptings NS-Vergangenheit tabu − oder sie wird kleingeredet. 1971 heißt es in einer Festschrift zum 350-jährigen Bestehen des einst als Lateinschule gegründeten THG: "Dass ein Mann wie Karl Epting, der während der Besatzungszeit eine nicht unwichtige Stellung in Paris innehatte, in die Verstrickungen, in die das NS-Regime viele unbescholtene Deutsche gebracht hat, mit hineingerissen wurde, gehört zur Tragik jener unheilvollen Jahre."
Und: Ein Mann von einem solchem Gedankenreichtum müsse als "Glücksfall" betrachtet werden, heißt es bei seinen Club-Freunden, den Rotariern. Noch 2005 wird diese Interpretation bei einem Vortrag über den honorigen Bürger wiederholt. 2017 fällt der Name Epting in der Reihe "Wissenpause im Deutschhof" beim Thema 68er Jahre mehrmals, doch seine NS-Vergangenheit wird nicht angesprochen. 2020 steht das 400-jährige Bestehen der Schule an. Höchste Zeit, die unrühmliche Vergangenheit des ehemaligen Direktors ins rechte Licht zu rücken.
Mut zur Erinnerung: „Zeitsprünge“ nennt der Kunsterzieher Joo Peter seine Projekte, mit denen er sich über Fotos, Montagen und Texte multimedial historischen Heilbronner Themen nähert. Aktuell ist er dabei, unter dem Titel „Mut zur Erinnerung“ die Historie der Heilbronner Schullandschaft aufzuarbeiten. Was Peter dabei über Karl Epting zutage brachte, sollte eigentlich erst später veröffentlicht werden. Doch weil das Thema plötzlich aktuell ist, schaltete er dieser Tage den Link im Internet frei: http://zeitsprünge-heilbronn.de. Peter hat viele Dokumente gesammelt und plant auch ein Buch zum Thema.
 Stimme.de
Stimme.de