Das Schiller-Nationalmuseum wird am 30. Oktober wiedereröffnet mit der neuen Ausstellung „Schiller!“. Die Renovierungsarbeiten kosten 400 000 Euro, das Ausstellungsprojekt wird vom Bund sowie von der Wüstenrot Stiftung mit 640 000 Euro unterstützt. Eintrittspreise Literaturmuseum der Moderne und Schiller-Nationalmuseum: 9 (7) Euro, Dienstag bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr. Das Museums-Café ist von 12 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen 12.30 Uhr bis 18 Uhr und im Winter bis 17 Uhr geöffnet.
Weltenbürger und widerständiger Dichter aus der schwäbischen Provinz
„Schiller!“, die neue Ausstellung im renovierten Schiller-Nationalmuseum in Marbach, wirft einen differenzierten Blick auf einen ganz Großen. Wie Friedrich Schiller zentrale Anliegen seiner Zeit thematisiert und wir ihn heute lesen.

Schiller der Rebell, Weltenbürger, der mehr in Gedanken denn realiter reist. Der Dichter mit dem unbändigen Freiheitsdrang, der sehr wohl strategisch denkt, Netzwerke aufbaut, mit seinem Tod zur Kultfigur wird. Der Idealist, der weiß, „der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“, in dessen Dramen Blut fließt und Rache menschlich ist. Der wie George Washington zum Ehrenbürger Frankreichs ernannt wird, der aus Württemberg flieht nach Mannheim, wo seine „Räuber“ bei der Uraufführung tumultartige Reaktionen auslösen, und der sagt: „Mein Clima ist das Theater, in dem ich lebe und webe“: Dieser 1759 in Marbach geborene Friedrich Schiller – er muss ein Typ gewesen sein.
Nicht aus der Heldengeschichte aussteigen, nur anders deuten
„Schillerklischees gibt es viele“, bemerkt Sandra Richter, die Direktorin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, als sie im Rahmen der Pressekonferenz zur neuen Dauerausstellung im Schillernationalmuseum gemeinsam mit Vera Hildenbrandt, Leiterin der Museen und Kuratorin, in die Neukonzeption einführt. „Auch wir steigen nicht aus der Heldengeschichte aus.“ Doch will Marbach die Schillersche Heldengeschichte differenzierter sehen und zudem andere Autoren zu Wort kommen lassen.
Im Zentrum der Ausstellung „Schiller!“ steht zweifelsfrei der Meister selbst, morgen wird die Schau eröffnet mit einer Rede von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Die aus dem um ein Vielfaches größeren Fundus ausgewählten 400 Exponate – Manuskripte, Briefe, Bücher, Raritäten, Bilder, Skulpturen – deuten die politische Dimension von Schillers Werk und Wirken. Eine Aufforderung, Schiller, den man missverstehen kann, neu zu lesen – im Sinne der Gedankenfreiheit.
Die Bühne als Experimentierfeld
„Lebe mit deinem Jahrhundert, aber sei nicht sein Geschöpf“, zitiert Richter, was als Leitgedanke gut taugt beim Rundgang im renovierten Schillermuseum. Unterteilt in neun Kapitel und Räume, die jeweils auch einzeln funktionieren, wirft die Schau Schlaglichter auf Schillers Leben. „Zum Dichter verurteilt? Schillers schwäbische Anfänge“ umreißt Themen seiner ersten Schreibversuche, den Drill an der Militärakademie Herzog Carl Eugens von Württemberg, aber auch ihr modernes Lehrangebot. Unter dem Slogan „Die Bühne als Experimentierfeld?“ widmet sich das nächste Kapitel Schillers Talent fürs Theater.
Auch wenn Schiller eine Zeit lang auf die Geschichtsschreibung setzt, ab Mitte der 1790er Jahre ist Schiller wieder Theaterautor, Regisseur, Übersetzer, Dramaturg. Seine Dramen sind auf der Bühne wie auch auf dem Buchmarkt Publikumserfolge. Schiller verdichtet Möglichkeiten politischen Handels, die Bühne ist dafür der sinnliche Ort. Kann Literatur Einfluss nehmen auf den Einzelnen, auf die Gesellschaft, fragt das Kapitel „Dichter der Freiheit? Europäische Werte in Schillers Texten“. Wie sind Begriffe wie Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit in welchem historischen Umfeld zu europäischen Werten geworden?
Schillers Reich ist der Gedanke
„Als ich während meines akademischen Lebens plötzlich eine Pause in meiner Poeterei machte und zwei Jahre lang mich ausschließlich der Medicin widmete, so war mein erstes Product nach diesem Intervall doch die Räuber“, schreibt Schiller 1789 und steht als frisch ernannter Professor für Geschichte erneut vor einer wissenschaftlichen Laufbahn. Solch phänomenale Mehrfachbegabungen mögen Zerrissenheit bedeuten – aber sind Literatur und Wissenschaft unvereinbare Gegensätze, untersucht der Raum „Medizin oder Poeterei?“.

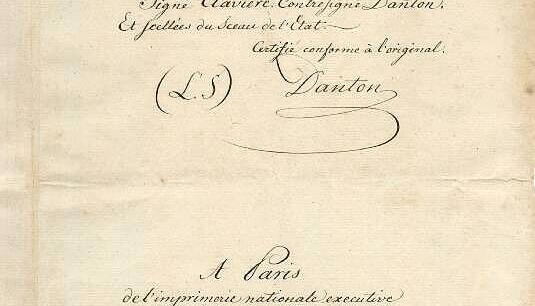
Wie es Schiller möglich ist, über Länder und zurückliegende Epochen zu schreiben, die er nie gesehen und erlebt hat, untersucht „Weltenbürger in Europa? Reisen und Schreiben“. Schillers unermessliches Reich ist der Gedanke, formuliert er in dem lyrischen Spiel „Die Huldigung der Künste“. Dieser Kraft der Sprache widmet sich der Raum „Was bleibt?“. Von Netzwerken und Strategie im Literaturbetrieb erzählt das Kapitel „Keine Trennung! Keiner allein?“. Schillers Weg zum freien Schriftsteller ist steinig, gepflastert von Geldsorgen und Schulden wie der Raum „Vom Schreiben leben?“ belegt. Ein Leben lang rechnet Schiller sich und anderen vor, was er im Alltag benötigt, wieviel Zeit für seine Projekte und welche Einnahmen er erwartet – nicht selten verrechnet er sich.
Vom Lesen und Gelesenwerden
Welche Klassiker Schiller fasziniert haben, wer seine Vorbilder sind und wie er selbst zum Vorbild, zur Kulturfigur wird, beleuchtet schließlich das Kapitel „Wie wird Schiller zum Klassiker? Lesen und Gelesenwerden“. Ein anregender Rundgang, zu jedem Kapitel gibt es zudem eine Intervention späterer Dichter und Denker. Was für ein Typ, dieser Schiller aus Marbach, der 1805 in Weimar stirbt.


 Stimme.de
Stimme.de