"Vorwurf kann ich nicht nachvollziehen"
Der Chef der Atomaufsicht wehrt sich gegen die Kernkraftgegner: Die Risiken werden nicht schöngeredet. Der Dialog ist mittlerweile erlahmt.
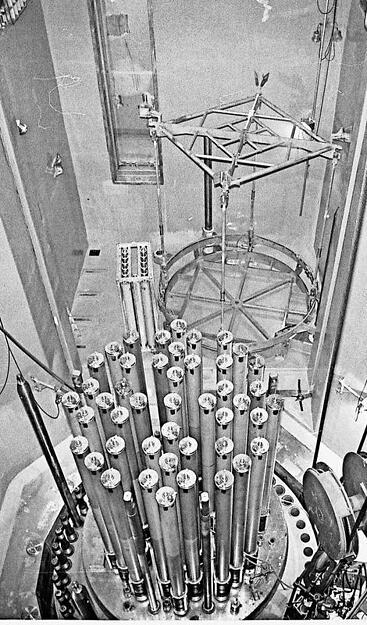
Die Angriffe aus der Anti-Atomkraftbewegung auf das vom Landesumweltministerium werden schärfer. Einige Bürgerinitiativen (BI) haben sich zum Beispiel aus der GKN-Infokommission zurückgezogen. Der Atomaufsicht werfen sie unter anderem vor, die Risiken der Kernkraft schönzureden. Das weist Gerrit Niehaus, Chef der Atomaufsicht, im Gespräch mit unserem Redakteur Reto Bosch zurück.
Herr Niehaus, warum ist die Atmosphäre zwischen Atomkraftgegnern und dem von einem Grünen geführten Umweltministerium so vergiftet?
Gerrit Niehaus: Atomkraftgegner bin ich auch. Es sind nicht die Atomkraftgegner an sich, mit denen die Atmosphäre vergiftet ist, es ist nur ein Teil von ihnen. Den Grund kenne ich nicht genau. Ich habe aber den Eindruck, dass sie von uns etwas verlangen, was wir nicht leisten können. Die Atomaufsicht ist eine in den Rechtsstaat eingebundene Behörde und muss sich bei ihren Entscheidungen an gesetzlichen Vorgaben orientieren. Die Hoffnung der Bürgerinitiativen, beispielsweise in den Infokommissionen mitentscheiden zu können oder ein Vetorecht zu haben, können wir nicht erfüllen.
Die Übernahme des Umweltministeriums durch den Grünen Franz Untersteller hat vielleicht die Erwartung geweckt, dass über eine strenger agierende Aufsicht GKN II schneller abgeschaltet wird.
Niehaus: Es gab ja einen starken Wandel infolge des Regierungswechsels. Der Umweltminister hat zum Beispiel vertuschte Ereignisse in Philippsburg rasch aufgeklärt. Das war ein tiefgreifender und an die Substanz gehender Prozess innerhalb der Atomaufsicht. Wir haben Fehler benannt und öffentlich gemacht. Bei der EnBW ist ein ganz gravierender Prozess hin zu einer besseren Sicherheitskultur angestoßen worden.
Aber wir handeln nach dem Atomgesetz. Wir können ein Kernkraftwerk nur dann abschalten, wenn ein Zustand besteht, aus dem sich Gefahren ergeben können. Wenn wir bei unseren sehr intensiven Kontrollen derartiges feststellen, gibt es garantiert kein Zögern. Einen Reaktor aus politischen Gründen stillzulegen, wäre grob rechtswidrig.
Können Sie konkrete Beispiele nennen?
Niehaus: Wir haben beispielsweise die Vielfalt der Sachverständigen erhöht. Früher wurden fast nur Tüv-Organisationen beauftragt. Zudem wurden Kontrollen ausgeweitet und verbessert.
In Neckarwestheim haben sich die Bürgerinitiativen jetzt zurückgezogen. Haben Sie Verständnis dafür? Mancher Kritikpunkt ist ja nachvollziehbar.
Niehaus: Nein, für den Rückzug der BIs habe ich überhaupt kein Verständnis. Die Kritik an einzelnen Aspekten, die mir auch nicht gefallen, muss man in diesem Gremium klären. Die Kommission ist im Übrigen kein Organ des Ministeriums, sondern es war eine bewusste Entscheidung, die Geschäftsführung in die Hände der Landratsämter zu legen. Wir haben deutlich gesagt, dass wir die Forderung nach einem Fragerecht für Zuschauer für berechtigt halten. Aber die Satzungsautonomie liegt eben in diesem Gremium.
Die Philippsburger haben das Fragerecht eingeführt, dort funktioniert das inzwischen ganz gut. Und wenn man für externe Experten Honorare zahlen will, kann das aus rechtlichen Gründen nicht über die Atomaufsicht direkt laufen. Dann müsste man diese aus dem - eventuell vergrößerten - Topf der Geschäftsstellen bezahlen. Davon abgesehen, haben die Bürgerinitiativen auch viel erreicht.
Was meinen Sie?
Niehaus: Alle gewünschten Themen wurden auf die Tagesordnung gesetzt, wir oder der Betreiber haben zu allen Fragen berichtet, die aufgeworfen worden sind.
Auch der BUND erwägt, in Neckarwestheim auszusteigen. Wäre das das Ende der Kommission?
Niehaus: Das Ende nicht, aber es wäre ein Schaden. Der BUND und die Initiativen waren die treibende Kraft im Gremium.
Wenn man sich die atomkritischen Gruppen herausdenkt, bleibt nicht viel an Diskussion übrig. Manche Bürgermeister und Abgeordnete scheinen die Sitzungen doch eher als lästige Pflichtübungen zu begreifen.
Niehaus: Das will ich nicht kommentieren. Bei einer Umfrage zu Verbesserungsmöglichkeiten war die Passivität mancher Bürgermeister schon ein Kritikpunkt. Aber das heißt ja nicht, dass sie sich nicht für die Themen interessieren.
Warum ziehen die Sitzungen, die ja doch viele Informationen bieten, nicht mehr Bürger an?
Niehaus: Man kann die Leute halt nicht in die Reblandhalle tragen. Man merkt in vielen Bereichen der Bürgerbeteiligung, dass Interesse häufig erst dann entsteht, wenn es zu persönlicher Betroffenheit kommt. Wenn ein Angebot nicht angenommen wird, kann man Hürden beseitigen, die Leute aber nicht zu ihrem Glück zwingen.
Insgesamt scheint der Dialog jedenfalls abzureißen. Viele Bürgerinitiativen nehmen an einem Workshop zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung nun doch nicht teil.
Niehaus: Den Workshop hatte ich mit Teilen der Umweltbewegung vereinbart. Es soll um die Frage gehen, wie Bürgerbeteiligung beim Thema Atomkraft verbessert werden kann. Wenn nun Organisationen verkünden, sich nicht mehr mit uns an einen Tisch setzen zu wollen: Was soll ich da noch sagen? Wir versuchen auf jeden Fall, die Gruppen, die bislang nicht boykottieren, bei der Stange zu halten.
Die Atomaufsicht steht in der Kritik. Kernkraftgegner aus den Reihen der BI werfen ihr vor, den "riskanten AKW-Betrieb schönzureden". Wie gehen Sie damit um?
Niehaus: Diesen Vorwurf kann ich nun gar nicht nachvollziehen. Gerade in der Infokommission klären wir sehr sachlich und konkret über die Risiken auf. Nur weil wir nicht permanent betonen, welch fürchterliche Technik die Kernkraft ist, heißt das noch lange nicht, dass wir etwas schönreden. Die Sicherheitsdebatte muss man auf einer fachlich sauberen Grundlage führen. Ich selbst weise oft genug darauf hin, dass Deutschland aus der Atomenergie aussteigt, weil die Risiken zu groß sind. Das unterscheidet uns im Übrigen von anderen, meist CDU-geführten Landesregierungen, die argumentieren, dass der Ausstieg politisch motiviert sei.
Vertreter der BI zweifeln die Glaubwürdigkeit der Atomaufsicht immer wieder an, weil das Land Miteigentümer der EnBW ist. Können Sie Interessenskonflikte ausschließen?
Niehaus: Das kann ich zu 100 Prozent ausschließen. Gerade unter einem Minister Franz Untersteller. Wie sollte das überhaupt funktionieren? Ruft die EnBW beim Minister an und sagt: Schau mal nicht so genau hin? Allein, dass der Staat an EnBW beteiligt ist, beeinflusst die Atomaufsicht nicht. Für die Landesbeteiligungen ist zudem aus gutem Grund nicht das Umweltministerium, sondern das Wirtschaftsministerium zuständig.
 Stimme.de
Stimme.de