Trivialliteratur für die Tränendrüsen
Heilbronn - Nur drei Stücke Heinrich von Kleists sind zu seinen Lebzeiten insgesamt 17 Mal aufgeführt worden. Allein 15 Aufführungen entfallen dabei auf das 1810 im Theater an der Wien uraufgeführte "Käthchen von Heilbronn".
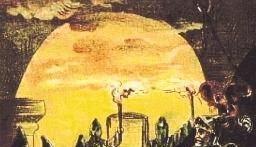
Zum großen Publikumserfolg im 19. Jahrhundert wird das Stück erst durch die umstrittene, stark vereinfachende Bearbeitung des Theatermanns Franz von Holbein − ein früher Fall von "Regietheater", wie es Günther Emig, Direktor des Heilbronner Kleist-Archivs Sembdner, formuliert. Allein diese Bearbeitung hat im 19. Jahrhundert 1200 Aufführungen erlebt. Die erste Aufführung des "Käthchen" in Heilbronn geht am 6. Januar 1835 unter dem Verfassernamen Holbein über die Bühne.
"Das Käthchen von Heilbronn" war zu diesem Zeitpunkt in den deutschsprachigen Theatern durchgesetzt, ein zugkräftiges Stück, das prima Kasse machte. 1822 nennt es der Hamburger Theaterprinzipal Friedrich Gottlieb Zimmermann das "eigentliche Nationalstück unserer deutschen Bühnen".
Volksausgaben
Auch volkstümliche Prosabearbeitungen des Käthchen-Stoffs von Johann Peter Lyser (1839) sowie spätere, in hohen Auflagen verbreitete Volksschriftenausgaben von dem in Wachbach bei Bad Mergentheim gestorbenen Pfarrer und Schriftsteller Ottmar Schönhuth mögen, so Emig, zur Popularisierung beigetragen haben. Als Grund für die Theaterbearbeitungen nennt Emig zum einen die Hässlichkeit Kunigundes, die nicht zum Theater als Ort der Erhebung passte, zum anderen die Herkunft Käthchens, die einer Affäre ihrer Mutter mit einem Unbekannten entstammt, dem Kaiser nämlich, wie sich später herausstellt. Käthchens vermeintlicher Vater Theobald ist also ein gehörnter Ehemann. Das Patriarchat duldete damals nicht, dass ein Familienoberhaupt derart der Lächerlichkeit preisgegeben wurde.
Billige Heftchen
Im 18. Jahrhundert wird der populäre Theaterstoff in Volksbüchern und Kolportageromanen verwurstet. Robert Frankenburg ist der völlig unbekannte Autor von "Das Käthchen von Heilbronn − Romantische Erzählung" mit sage und schreibe 3196 Seiten. Erschienen ist er um 1900 in Dresden als billig aufgemachte Arme-Leute-Lektüre in 100 Heftchen, Stückpreis zehn Pfennig. Sie bedienen eher die Tränendrüsen als das Hirn und vermischen den Käthchen-Mythos ungeniert mit anderen Kleist-Stücken: Trivialliteratur für Dienstmädchen und Fabrikarbeiter.
1869 hatte ein gewisser Stanislaus Graf Grabowski in seinem in Berlin erschienenen Kolportageroman Kleists "Käthchen" um württembergische Elemente angereichert. In dem 1200-seitigen Schmöker mixt er munter den Götz und die Schwarze Hofmännin unter die Käthchen-Geschichte: Hochliteratur wird Volkssage. Das Kleist-Archiv Sembdner hat übrigens Nachdrucke beider Romane veröffentlicht, die in Bibliotheken wie auf dem Antiquariatsmarkt extrem rar sind.
 Stimme.de
Stimme.de
Kommentare