Neue Website erzählt vom jüdischen Leben in der Region
Das Kreisarchiv und das Museum zur Geschichte der Juden haben eine neue Website vorgestellt. "Der Raum Heilbronn ist seit mindestens 1000 Jahren von jüdischem Leben und jüdischer Kultur geprägt", sagt Kreisarchivarin Petra Schön. Der Jüdische Kulturweg in der Region Heilbronn wird nun ergänzt.

Der Jüdische Kulturweg im Heilbronner Land ist eröffnet. Zumindest virtuell. Kreisarchivarin Petra Schön und Heinz Deininger, der Vorsitzende des Freundeskreises der ehemaligen Synagoge in Affaltrach, haben die neue Website im Landratsamt vorgestellt. Sie erinnert an jüdisches Leben in 19 Landkreiskommunen und der Stadt Heilbronn.

Es ist ein Herzensprojekt, das nach zwei Jahren Arbeit fertiggeworden ist - als Ergänzung zu den vielen Orten, die besichtigt werden können. Am 3. September wird der Jüdische Kulturweg im Heilbronner Land in Affaltrach eingeweiht. Zahlreiche Veranstaltungen im gesamten Landkreis Heilbronn flankieren das Ereignis am 3. September und danach. Das Datum ist kein Zufall: Die Einweihung fällt auf den Europäischen Tag der jüdischen Kultur.
Jüdisches Leben in der Region: Website zum Jüdischen Kulturweg am Start
Die Website kann unter www.juedischer-kulturweg-heilbronnerland.de ab sofort eingesehen werden. Sie lädt historisch interessierte Leserinnen und Leser zum Entdecken ein. Zusätzlich gibt es draußen an historisch bedeutsamen Orten neue Informationstafeln oder Stelen: "Dort, wo es noch keine gab", erklärt Petra Schön. Über einen QR-Code kommen Interessierte auf vertiefende Informationen im Netz.
Und so ist die Website das Herzstück eines ambitionierten Projekts. Die Informationen, die dort zugänglich gemacht worden sind, sind eine Fortschreibung des Grundlagenbuchs "Jüdische Gemeinden in Kreis und Stadt Heilbronn", das der langjährige Kreisarchivar Wolfgang Angerbauer und der ehemalige Redakteur der Heilbronner Stimme, Hans Georg Frank, in den 1980er-Jahren veröffentlicht haben.
Ergänzung zum Grundlagenbuch von Angerbauer und Frank
Petra Schön hält die digitale Darstellungsform für zeitgemäß: "Für mich ist es aber auch wichtig, dass wir die authentischen Orte haben - und die Leute die Möglichkeit haben, dorthin zu gehen." Touren sollen noch zusammengestellt werden. Aber in Städten wie Bad Friedrichshall oder Eppingen, wo gleich mehrere Stationen zu finden sind, können sich Interessierte anhand der Website schon jetzt ihre Spurensuche selbst zusammenstellen.
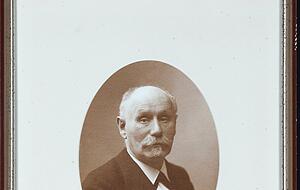
"Der Raum Heilbronn ist seit mindestens 1000 Jahren von jüdischem Leben und jüdischer Kultur geprägt", betont Petra Schön. Der älteste Nachweis ist der Nathanstein, der in Heilbronn beim Umbau des Marktplatzes Anfang der 1950er-Jahre gefunden worden ist. In Heilbronn, Neudenau und Wimpfen lebten bereits im 11. bis 13. Jahrhundert Menschen jüdischen Glaubens. Nachdem sie im Spätmittelalter aus vielen Städten vertrieben worden waren, entstanden im Kreisgebiet zahlreiche jüdische Gemeinden, bis der Nationalsozialismus dem vormals blühenden jüdischen Leben ab 1933 gewaltsam ein Ende setzte.
Aufarbeitung jüdischer Geschichte in der Region Heilbronn: Das waren die Kosten
Den Impuls, an der Aufarbeitung der jüdischen Geschichte in Stadt- und Landkreis Heilbronn mit einer leicht zugänglichen Publikation weiterzuarbeiten, ging von einem Jubiläum aus. Der Bund stellte dem ausrichtenden Kölner Verein "321-2021: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" einen Etat in Höhe von 50 Millionen Euro, mit dem unterschiedliche Projekte finanziert wurden.
Heinz Deininger als Vorsitzender des Freundeskreises ehemalige Synagoge Affaltrach bewarb sich: 36.600 Euro flossen in die Region. Insgesamt 41.600 Euro kosteten Website, Honorare für Autoren oder Bildrechte. Die Fäden für die Inhalte liefen bei Petra Schön im Kreisarchiv zusammen. "Im Moment haben wir zirka 30 einzelne Orte in Stadt- und Landkreis Heilbronn mit 60 Stationen aufgelistet." Weitere kämen noch dazu. Und auch dafür eignet sich das Netz gut: Liegen neue Erkenntnisse vor, kann die Website jederzeit aktualisiert und erweitert werden.
Jüdischer Kulturweg kann jederzeit erweitert werden

Viele der so gebündelten Informationen drehen sich um Gebäude. Manche von ihnen, wie die ehemalige Synagoge in Heinsheim, werden zwischenzeitlich saniert als Kultur- und Begegnungsstätte betrieben. In Massenbachhausen trägt die ehemalige Synagoge in der Gartenstraße 3 den Namen Firminushaus: 1826 erbaut, wurde das in der NS-Zeit erhalten gebliebene Haus zwischen 2007 und 2009 saniert. Seinen aktuellen Namen hat es von dem Katholiken Bruder Firminus erhalten, der vom Papst 1998 den Titel "Ehrwürdiger Diener Gottes" erhalten hatte und als ein großer Sohn des Ortes gilt.
Über solche Orte hinaus habe man versucht, "auf die Bevölkerung einzugehen. Was haben die Menschen gemacht? Wie haben sie gelebt?", erklärt Petra Schön. Zahlreiche Porträts sind das Ergebnis dieses Bemühens. "Vom Wirtshaus der Familie Gumbel zum Rathaus von Stein am Kocher" berichtet von der Herkunft des Abraham Gumbel: Dieser war im 19. Jahrhundert nach Heilbronn gegangen, wo er unter anderem den Heilbronner Bankverein gründete. Der Veranstaltungssaal der Volksbank Heilbronn ist nach ihm benannt.
Wissenschaftliche Arbeiten mit Quellenangaben
"Die Themen sind wissenschaftlich erarbeitet, die Quellen sind unten auf der Seite angegeben und teilweise verlinkt", erklärt Petra Schön. So ist die neue Website ein echter Fundus - auch, wie Schön betont, für die Nachkommen der jüdischen Familien, die die Region Heilbronn in der NS-Zeit verlassen mussten.
Weitere Kapitel, etwa über Mikwen, von denen man zwischenzeitlich weiß, wo sie waren, werden noch eingearbeitet: Neue Informationen aus dem Vermessungsamt haben die Historiker auf neue Spuren geführt. "Seit der Verwaltungsreform gehört das Vermessungsamt zu uns, und wir sind auch räumlich näher dran", sagt Petra Schön: "So kommt man auch besser an das Material heran."
Der neue Jüdische Kulturweg verbindet 19 Landkreiskommunen und die Stadt Heilbronn miteinander
Der Raum Heilbronn ist seit mindestens 1000 Jahren von jüdischem Leben und jüdischer Kultur geprägt. In 19 Landkreiskommunen und in der Stadt Heilbronn macht der Jüdische Kulturweg Station. Insgesamt 60 Orte zeugen von den Menschen und deren Spuren, die sie hinterlassen haben. Vertiefende Informationen gibt es auf der Website unter www.juedischer-kulturweg-heilbronnerland.de.
Die Website ist ab sofort freigeschaltet. Dort findet sich auch ein Veranstaltungskalender. An den Texten haben unterschiedliche Autorinnen und Autoren mitgewirkt. Die Orte und Geschichten können gezielt aufgerufen werden.
- Bad Friedrichshall: zur ehemaligen Synagoge, zum Geckenschloss, zum jüdischen Friedhof und zu der Gedenkstätte für das Konzentrationslager im Ortsteil Kochendorf.
- Bad Rappenau: zu der "Corsettfabrik Eugen Herbst", später "Felina", Kirchenstraße 6, zur ehemaligen Synagoge in Heinsheim, zum Verbandsfriedhof ebenda und zur Deinhardstraße im Bad Rappenauer Ortsteil Wollenberg.
- Bad Wimpfen: zum HaLevi-Haus (ehemaliger Betsaal) im Schwibbogen 5.
- Eppingen: zur Alten Synagoge in der Küfergasse, zur Neuen Synagoge in der Kaiserstraße 6, zur Alten Universität in der Altstadtstraße, zu ehemaligen jüdischen Geschäftshäuser in der Brettener Straße und in der Bahnhofstraße, zur Metzgergasse in Eppingen, zum jüdischen Verbandsfriedhof sowie zum Haus Sternweiler in der Fleischgasse 5.
- Gemmingen: zu den jüdischen Gemeinden in Gemmingen und in Stebbach.
- Heilbronn: zur ehemaligen Synagoge auf der Allee, zur "Zigarre", der Fabrik der Gemminger Familie Kahn, zum israelitischen Friedhof im Breitenloch, zur jüdischen Geschichte des Horkheimer Schlosses, zu Fabrikantenvilla Wolf, zur Villa Picard, zum Landesasyl Wilhelmsruhe, zum jüdischen Friedhof und zum jüdischen Leben allgemein in Sontheim. Außerdem verweist die Website auf Spuren jüdischen Lebens im Haus der Stadtgeschichte im Deutschhof.
- Ittlingen: zur ehemaligen Synagoge, zum jüdischen Friedhof und zum Gurs-Mahnmal auf dem Ittlinger Friedhof.
- Jagsthausen: zur jüdischen Gemeinde mit der jüdischen Schule im Ortsteil Olnhausen.
- Kirchardt: zur jüdischen Gemeinde in Berwangen.
- Lehrensteinsfeld: zur ehemaligen Synagoge, zur Judengasse, zum Rabbinat und zum Landwirtschaftlichen Lehrgut. Außerdem gibt es Informationen zu den Gasthäusern Henle und "Zum Ochsen".
- Leingarten: zu der ehemaligen Synagoge in Schluchtern.
- Massenbachhausen: zur ehemaligen Synagoge, in der sich jetzt das Firminushaus befindet.
- Möckmühl: zur ehemaligen Synagoge in Korb.
- Neckarsulm: zum jüdischen Friedhof.
- Neudenau: zur ehemaligen Synagoge, zur Judengasse und zum jüdischen Friedhof.
- Neuenstadt am Kocher: zur jüdischen Gemeinde, zum Wirtshaus der Familie Gumbel, zum Rathaus und zum jüdischen Friedhof in Stein am Kocher.
- Obersulm: zur jüdischen Gemeinde und zum jüdischen Friedhof in Affaltrach, zur ehemaligen Synagoge, zum Gasthaus "Rose" und zum jüdischen Zwangsaltersheim in Eschenau.
- Schwaigern: zu den Freiherren von Massenbach und das dortige jüdische Leben seit dem 16. Jahrhundert; zum jüdischen Leben im Zentrum von Massenbach und zu dem Gedenkstein für die Opfer der Shoa ebenda.
- Siegelsbach: zur ehemaligen Synagoge und Mikwe in der heutigen Hauptstraße sowie zur Villa Grötzinger in der Hauptstraße 68.
- Talheim: zur Ganerbenburg und zur jüdischen Gemeinde.
- Untergruppenbach: zur Burg Stettenfels und Geschichte des Schuhfabrikanten Levi.
Kommentare öffnen

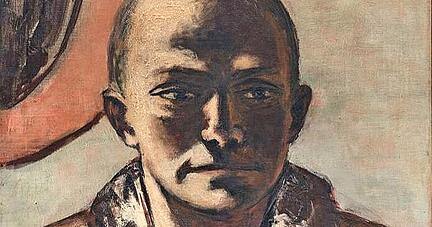
 Stimme.de
Stimme.de
Kommentare