Krisen können Energien freisetzen
Preise für Michael Kannenbergs Doktorarbeit über Endzeiterwartung
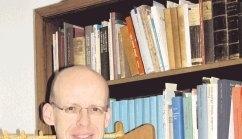
KÜnzelsau - Michael Kannenberg ist als zweifacher Vater, Religionslehrer und Stadtrat niemand, der die Hände pessimistisch in den Schoß legt. Wie kommt jemand, der so mitten im Leben steht, dazu, seine Doktorarbeit über ein Thema zu schreiben, das für Otto Normalverbraucher höchst abseitig klingt: "Verschleierte Uhrtafeln - Endzeiterwartungen im württembergischen Pietismus zwischen 1818 und 1848".
Das ist eine lange Geschichte, die ihre Ursprünge im Theologiestudium und Auslandssemester Kannenbergs anno 1989 in Basel hat. Dort begann er, sich mit dem Thema Pietismus und schließlich mit der Endzeiterwartung der Pietisten zu beschäftigen. Sie lasen nicht nur das Ende der Zeiten aus der wörtlich genommenen Johannes Offenbarung heraus, sondern sogar die Chronologie des Geschehens und erwarteten im Jahr 1836 den Anbruch des 1000-jährigen Reiches und die Wiederkehr Christi.
Aktivierungsprogramm Dass Pietisten allerdings passiv auf das Ende der Welt und den Anbruch der Herrschaft Christi auf Erden warteten, ist ein Irrtum. "Endzeiterwartungen sind eher ein Aktivierungsprogramm", erklärt Kannenberg. Schließlich wollte man sich der besseren Zukunft würdig erweisen. Zwar teilt Michael Kannenberg diese Weltsicht nicht, die sich übrigens in vielen Religionen findet, aber "es ist beeindruckend, wie aus einer solchen Glaubenshaltung heraus enorme Energien entstehen", erklärt er eine der Wurzeln seiner Faszination für dieses Thema. Eine andere liegt in der Fähigkeit einer jungen Pfarrergeneration im 19. Jahrhundert begründet, die dafür gesorgt hat, "dass die Enttäuschung der pietistischen Laien aufgefangen wird", als sich abzeichnete, dass die Herrschaft Christi auf Erden nicht wie erwartet 1836 anbricht.
Es gelang ihnen, diese lineare Zeitauffassung zu durchbrechen, den Menschen neuen Mut zu geben und sie wieder im Hier und Jetzt zu verankern. Außerdem ebneten sie den Pietisten den Weg, zurück in die württembergische Landeskirche. Das erklärt nicht nur das Phänomen, dass bis heute der Pietismus in der württembergischen Landeskirche stärker als anderswo vertreten ist. "Vieles, was heute in der Landeskirche politisch und darüber hinaus läuft, ist vergleichbar mit der damaligen Zeit", spannt Kannenberg den Bogen vom historischen Stoff seiner Doktorarbeit in die Gegenwart.
Zwei Preise Gleich mit zwei Preisen - dem Johannes-Brenz-Preis der Landeskirche und dem Phillip Matthäus-Hahn-Preis für Pietismusforschung - wurde Kannenberg für seine Arbeit nun ausgezeichnet. Das macht ihn zwar stolz, zumal dieser "Doppelschlag" nicht erwartet war, doch aus seiner Beschäftigung mit der pietistischen Endzeiterwartung zieht er noch ganz andere Impulse für seine Arbeit als Theologen.
Auch wenn Kannenberg als moderner Theologe die Bibel nicht wie die Pietisten wörtlich, sondern metaphorisch auslegt, schätzt er ihren ganzheitlichen Umgang mit der Heiligen Schrift. Vom friedlichen Leben, das sie fordert, sei man nach wie vor weit entfernt "und das heißt, sich nicht zufrieden zu geben mit der Welt, wie sie sich heute darbietet". Und dass gerade dazu Krisen Energien freisetzen können, ist eine Erkenntnis aus der Pietismusgeschichte, die auch heute Mut machen kann.
Kommentare öffnen Stimme.de
Stimme.de
Kommentare