Künstliche Intelligenz soll dienen, nicht herrschen
Der Philosoph Christoph Quarch fordert beim Gästeabend der BW Bank menschliche Führung beim Umgang mit neuen Technologien. Die Frage lautet: Was wollen wir wirklich?
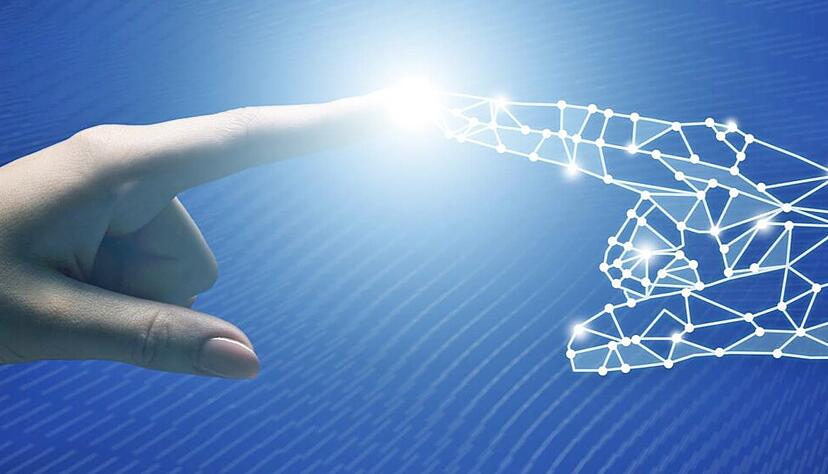
Mensch oder Maschine? Wer bestimmt in Zukunft über unser Leben? Diese Frage dürfte vielen Zeitgenossen absurd vorkommen. Doch mit dem Aufkommen der künstlichen Intelligenz (KI) stellt sie sich immer drängender. "Die Menschheit steht an einer epochalen Schwelle", sagt Christoph Quarch beim 45. Gästeabend der BW Bank in Rauers Guter Stube in Untereisesheim.
Der Philosoph aus Fulda spricht vom Übergang von der analogen Ära in die digitale Zeit. Dass in dieser Zeit die künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle spielt, steht außer Frage. Selbstlernende Systeme könnten den Menschen immer mehr Entscheidungen abnehmen - bis sie am Ende selbst die Richtung menschlichen Handelns vorgeben.
Sind Menschen nur Algorithmen?
Das ist keine Dystopie, sondern ein durchaus realistisches Zukunftsszenario. Quarch verweist auf die Experten im Silicon Valley, für die ausgemacht ist, dass Menschen letztlich nur Algorithmen sind - mit der logischen Folge, dass Maschinen die besseren Menschen wären, weil sie effizient Probleme lösen und Fehler vermeiden. Schließlich, da ist sich nicht nur Philosoph Quarch sicher, wird künstliche Intelligenz irgendwann in der Lage sein, sich selbst zu programmieren. Und diese Superintelligenz kann Ziele selbst festlegen.
Diese Gefahr erkannte schon Konrad Zuse, der 1941 in Berlin den ersten Computer der Welt präsentierte. "Die Gefahr, dass der Computer so wird wie der Mensch, ist nicht so groß wie die Gefahr, dass der Mensch so wird wie der Computer", sagte der Erfinder damals.
KI im Zeichen der Zweckrationalität
Warum diese Gefahr heute so groß ist wie nie zuvor, zeigt Quarch an der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die sich stets an Zweckrationalität orientiert habe. Entwickelt worden sei sie in den USA zu Zeiten des Kalten Krieges mit dem Ziel, die Russen in Schach zu halten.
Nach dessen Ende erhielt die KI Einzug in die Wirtschaftswelt - an der Wall Street wird sie eingesetzt, um größtmöglichen monetären Nutzen zu erzielen. Diese egoistische Menschenbild prägte bereits der Wirtschaftsphilosoph Adam Smith, später wurde daraus der nur auf den eigenen Vorteil bedachte Homo Oeconomicus.
Der Mensch ist nicht nur Egoist
Noch ist für Quarch nicht ausgemacht, dass wir nach dem Militär und der Ökonomie auch unser soziales Leben dem Primat der Zweckrationalität unterordnen. "Die wichtigste Frage lautet: Was wollen wir wirklich?", fordert er die 100 Unternehmer zum Nachdenken auf. "Wir sind nicht nur rationale Egoisten, sondern immer auch empathische Wesen der Verbundenheit", sagt er. Der Mensch wolle lebendig und kreativ sein, suche nach einem Sinn. Dies könne keine KI ersetzen.
Die Menschen haben es demnach selbst in der Hand, ob sie die künstliche Intelligenz in den Dienst des Lebens stellen oder das Leben in den Dienst der künstlichen Intelligenz.

 Stimme.de
Stimme.de